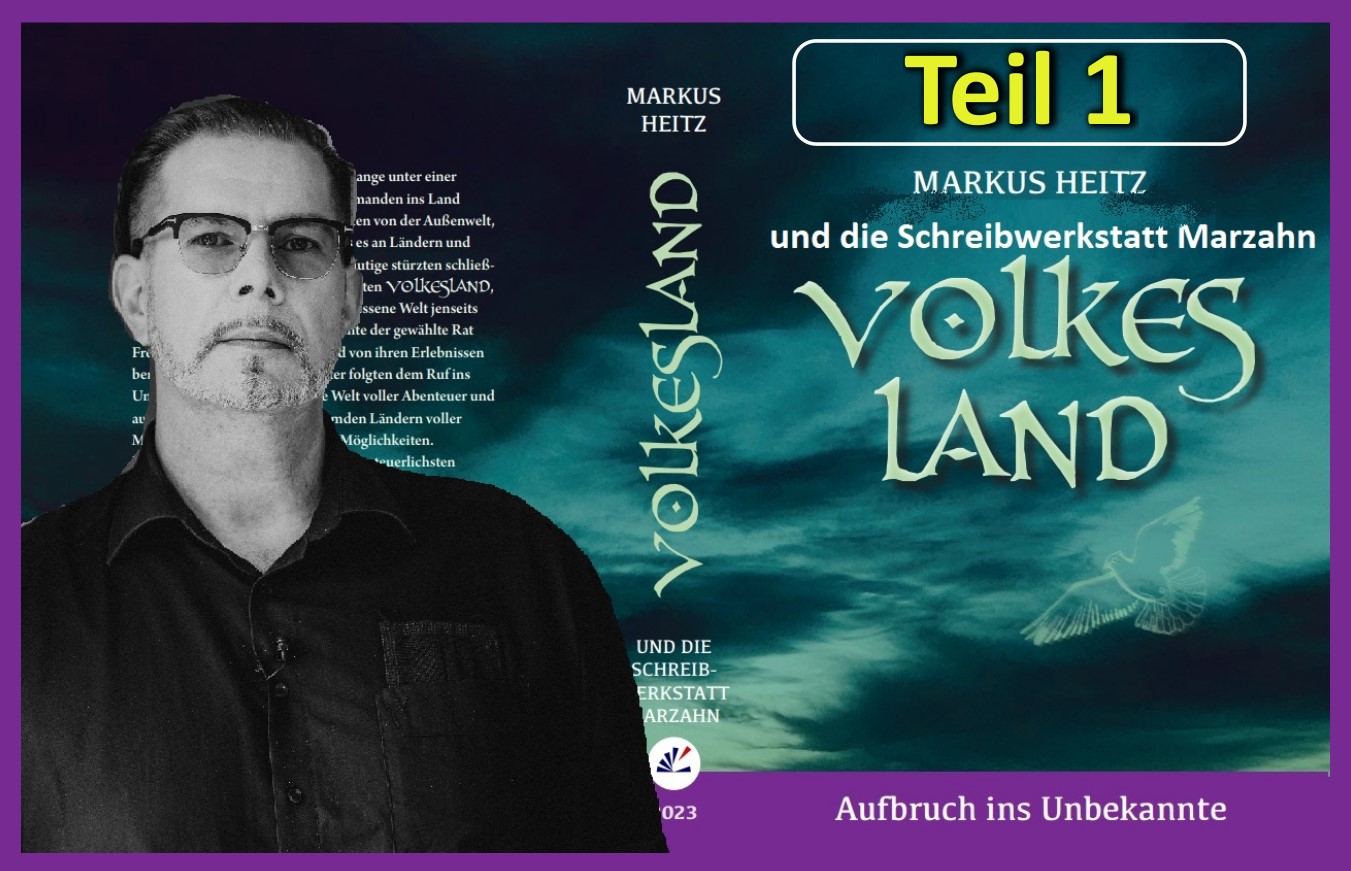21.01.24 Auch im vergangenen Jahr schrieben die Mitglieder der Schreibwerkstatt für Jugendliche der Mark-Twain-Bibliothek einen Roman zusammen. Und wie schon im vergangenen Jahr wird es hier an dieser Stelle jeden Sonntag daraus eine Fortsetzungsfolge geben. Heute beginnt Pia Vahl mit dem ersten Kapitel ISTORIA:
Erstes Kapitel
Gab es eine Geschichte, die noch nicht existierte?
Wiederholte sie sich nicht ständig? Sei es die Geschichte der Zivilisation, welche
von Kriegen und Auseinandersetzungen geprägt war, aus denen niemand zu lernen schien oder den zahlreichen Büchern, die sich alle an derselben Idee eines einzigartigen Helden orientierten. Gab es in dieser Welt nicht unzählige Geschichten wie meine, die sich in ihrer bedeutungslosen Eintönigkeit immerzu wiederholten?
Gab es eine Geschichte, die noch nicht existierte?
Wann meine Geschichte begann, wusste ich nicht. Ob sie bereits zum Zeitpunkt meiner Geburt begonnen hatte, konnte ich beim besten Willen nicht sagen.
Für mich begann sie, als ich die Grenzen von Volkesland überquerte und mich einer neuen Welt gegenübersah.
Ich hatte nie damit gerechnet, jemals die Möglichkeit zu haben, mein Heimatland zu verlassen. Seit Generationen hatte kein einziger Bewohner die Grenzen überschritten.
Immerhin hatte die Königsfamilie dies angeordnet. Doch das Land, welches unter deren Herrschaft gelitten hatte, gab es nun nicht mehr. Die Monarchie wurde nach Jahren der Tyrannei gestürzt.
Es hatte einige Zeit gedauert, bis das Land wieder organisiert war, doch letztendlich war der Umbruch gelungen. Mehr als das. Denn dies war die Geburtsstunde von Volkesland gewesen.
Ein Land, in dem das Volk, welches aus den verschiedensten Wesen bestand, über sich selbst regierte

Illustration: Isabell Geger
. Und der Rat, der nun an der Spitze stand, hatte das
gesamte Volk um Hilfe gebeten, um in die umliegenden Länder zu reisen und diese
zu erkunden. Denn während der monarchischen Herrschaft waren andere Länder,
ihre Bewohner, Traditionen und tausende von Geschichten verloren gegangen.
Es war an der Zeit, 200 Jahre der selbstverschuldeten Ausgrenzung hinter sich zu
lassen und zu überwinden, um sich in die Welt neu eingliedern zu können.
Hier stand ich also. Im Rücken die nördliche Grenze von Volkesland und vor mir
ein kleines Fleckchen Land, das auf der schemenhaften Karte, welche der König auf-
bewahrt hatte, kaum zu erkennen gewesen war. Dennoch hatte es sich ergeben, dass
ich diesen Fleck erkunden sollte. Vielleicht brauchte es keine gigantische Fläche, um
11
zu einem einzigartigen Ort zu werden. Und ich war mehr als bereit herauszufinden,
welche Geheimnisse man hier zu finden vermochte.
So dachte ich zumindest zu Anfang. Doch mehrere Wochen des Herum-
wanderns, ohne fündig zu werden, setzte meinem Gemüt deutlich zu. Es war
frustrierend. Dabei war ich mir nicht einmal sicher, wonach ich eigentlich suchen
sollte. Also stapfte ich weiter. Das Land hatte nicht viel mehr zu bieten als einen
Wald mit diversen kleinen Lichtungen und Sümpfen, welche die Reise zusätzlich
erschwerten.
Kleine Wesen, die für mich wie Feen aussahen, kreuzten des Öfteren meine Wege
und saßen auf den kleinen Stängeln von farbenfrohen Blumen. Manchmal glaubte
ich, dass sie mich beobachteten.
Sie schienen die einzigen Wesen in diesem Land zu sein. Zumindest war mir bis
zu diesem Zeitpunkt kein anderes unter die Augen gekommen und Spuren hatte
ich ebenfalls keine bemerkt.
Ich spürte, wie die Einsamkeit auf mir lastete. Mehrere Wochen ohne jeglichen
sozialen Kontakt war ich nicht gewöhnt. In Volkesland traf man zu jeder Tageszeit
auf Leute oder Feste. Lächelnd dachte ich an die kleine Hütte, in der ich lebte. Sie
war nahe der Bibliothek gelegen, die seit der Reform wesentlich gefüllter war. Es
war angenehm zu sehen, wie sie sich weiter füllte und füllte. Jede Woche trafen neue
Lieferungen an Büchern und Schriftrollen ein, die in dem Palast oder in anderen
Gebieten im Land gefunden wurden.
Und trotzdem wurde ich dort nicht fündig. Ich verstand den Grund dafür nicht,
doch ich hatte das ständige Gefühl, auf der Suche zu sein.
Ich seufzte und legte die Karte, die ich versuchte zu füllen, neben mir auf dem
Stein ab und starrte in den nur schemenhaft zu erkennenden Sonnenuntergang.
Der heraufziehende Nebel versperrte mir die Sicht und brachte eine noch immer
recht winterliche Kühle mit sich.
Tröstend zog er sich um die hohen Kiefern und Fichten und läutete damit den
Beginn der Nacht ein.
Ich verweilte noch einen Moment, bevor ich mich aufrappelte, um ein Lager für
die Nacht zu suchen.
In diesem Augenblick bemerkte ich die Bewegung aus dem Augenwinkel.
Erschrocken zuckte ich zusammen, als sich eines der kleinen Wesen neben mir
auf dem Felsen niederließ. Ihre leicht schimmernden kleinen Flügel schwirrten in
der Luft, nicht unähnlich einem Insekt. Die Haut war leicht bläulich, sodass man
meinen konnte, es wäre krank. Doch die kleinen Beine zappelten freudig in der Luft,
während mich das Wesen frech angrinste. Ich kniff die Augen leicht zusammen, aber
12
ich verstand beim besten Willen nicht, was es sagen wollte. Es begann nun auch
mit den kleinen Ärmchen herumzufuchteln und in der Luft umherzuspringen. Als
das Wesen bemerkte, dass ich kein bisschen von dem verstand, was es mir mitteilen
wollte, flog es davon. Ich zögerte kurz, bevor ich hinterher ging.
Das Wesen führte mich fernab der mir bekannten Wege, während der Nebel
immer dichter wurde, sodass ich die Bäume um mich herum kaum noch wahr-
zunehmen vermochte und über alle möglichen Wurzeln und Gestrüpp stolperte.
Mein Zeitgefühl schien mich zu verlassen. Ich konnte nicht einschätzen, wie lange
ich dem leuchtenden, verschwommenen Punkt vor mir folgte. Meine Hose wurde
von Dornen zerrissen und meine Füße begannen zu schmerzen.
Nach einer mir ewig vorkommenden Zeit, lichtete sich der Nebel und ich trat
auf eine kleine Lichtung im Wald. Ich war schon öfter an dem kleinen Bach vorbei-
gekommen und hatte mich über die nahgelegene, zugeschüttete Höhle gewundert.
Was bei Tag einen friedvollen und lieblichen Eindruck gemacht hatte, stellte sich
bei Nacht als ein mysteriös wirkender Ort dar. Das Mondlicht tauchte das Wasser
in silbernen Glanz, doch die Steine drum herum wirkten mit ihren viel zu großen
Schatten beängstigend und stumpf. Kein Wind wehte durch die Gräser und kein
Tier durchstreifte die Umgebung, sodass die Lichtung vollkommen still dalag.
Diese Stille war fast beängstigender als die langgezogenen Schatten der umlie-
genden Fichten, die starr zum Himmel emporragten.
Das kleine Wesen war verschwunden. Ich glaubte zu träumen, als mein Blick auf
die Höhle fiel, die ich bereits einmal betrachtet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie
eindeutig verschüttet und nicht zugänglich gewesen. Doch der Eingang war sperr-
angelweit offen. Es wirkte beinahe verlockend, hineinzugehen, trotz der Dunkel-
heit, die mich anzuspringen schien.
Mehrere Minuten stand ich lediglich am Rand der Lichtung und starrte die Höhle
an, als würde sich die Illusion im nächsten Moment wieder auflösen. Doch es pas-
sierte nichts dergleichen. Stattdessen hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden,
was den gesamten Ort noch bizarrer machte. Allerdings war die Sonne bereits
vollkommen vom Himmel verschwunden und es wurde immer kälter. Außerdem
wollte ich nicht herausfinden, welche Tiere sich hier bei Nacht herumtrieben, wes-
halb ich mich unter einem nahgelegenen Felsvorsprung zusammenrollte und die
Augen schloss.
Es dauerte lange, bis ich eingeschlafen war.
Ich erwachte erst, als die Sonne bereits hoch am Horizont stand und die Lichtung
wieder in goldenes Licht tauchte, was mich das beängstigende Szenario von letzter
Nacht beinahe vergessen ließ. Verschlafen rappelte ich mich auf und schaute in die Augen des kleinen Wesens. Erschrocken schrie ich auf und stieß mir meinen Kopf
am Felsen. Ein stechender Schmerz jagte durch mich hindurch, sodass ich das Flu-
chen nicht unterdrücken konnte.
„Verdammte Fee“, knurrte ich und starrte das Wesen an. Es lachte mich aus.
Zumindest verstand ich das schrille Summen als solches, was mich noch wütender
machte. Kräftiger als nötig klopfte ich mir den Dreck von meinem Gewand
und machte mich auf den Weg zum Bach, um meiner morgendlichen Hygiene
nachzugehen.
Die Höhle hatte sich nicht verändert. Der Eingang klaffte noch immer als dunkles
Loch in der Steinwand. Es war so dunkel, dass man nicht einmal erahnen konnte,
wo dieser Weg hinführen würde.
Zieht los und erkundet! hatte es in dem Ausruf des Rates gelautet. Mögen die
guten Mächte mit euch sein, dass euch nichts Böses widerfährt. Und falls doch,
sollt ihr damit umgehen können. Ich starrte das Loch in der Wand an und seufzte.
Ich war wohl kaum hergekommen, um meine Zeit in einem sumpfigen Wald mit
nervigen summenden Feen zu verbringen. Entschlossen stand ich auf und wendete
mich der Höhle zu.
Fast, als hätte die Fee meine Gedanken erraten, tauchte sie wieder neben mir auf
und setzte sich wie selbstverständlich auf meine Schulter, wie um zu sagen: „Keine
Sorge, ich komme mit.“ Für einen kurzen Moment überlegte ich, sie einfach abzu-
schütteln. Doch letztendlich kam ich zu dem Entschluss, dass ich Gesellschaft – sei
es auch nur von einer kleinen blauen Fee – in einer dunklen Höhle gut gebrauchen
konnte.
Dann setzte ich mich in Bewegung und betrat die Höhle.
Die Luft war muffig und abgestanden. Staub und Dreck traten mir in die Augen
und ich musste blinzeln. Mein Hals begann bereits zu kratzen, und ich hustete den
Staub aus meiner Lunge. Auch die kleine Fee musste mehrere Male niesen.
Den Staub aus der Luft wedelnd, ging ich weiter. Der Gang führte hinunter in die
Erde, was zwar zum einen bedeutete, dass es feuchter und somit weniger staubig
werden würde, zum anderen würde es jedoch auch kühler werden, sodass ich mir
meinen dünnen Umhang fester um die Arme zog. Die Fee fungierte als minimale
Lichtquelle. Gerade so weit, dass ich den ebenen Boden und die ausgearbeiteten
Wände betrachten konnte. Darauf waren verschiedene Abbildungen zu sehen. Sie
zeigten die unterschiedlichsten Landschaften mit kleinen, mir größtenteils unbe-
kannten Tieren. Ich sah Burgen oder Schlösser, welche majestätisch auf großen
Hügeln thronten. Auf anderen Bildern konnte ich Meere und Strände erkennen,
welche sich über mehrere Meter an der Wand entlang zogen.
14
Die künstlerischen Feinheiten konnte man nur bewundern. Trotz der bereits
verblassten Farben zeugten die Abbildungen von imposanten Farbverläufen wie
auf dem abgebildeten Sonnenuntergang, den ich zu Beginn des Ganges gesehen
hatte.
Staunend folgte ich dem Tunnel hinab in die Tiefe. Erstaunlicherweise nahm die
Temperatur nicht weiter ab. Tatsächlich war es angenehm und meine Füße führten
mich immer schneller voran. Mein Puls schoss vor Aufregung und Vorfreude auf
das, was sich am Ende befinden würde, in die Höhe.
Die Fee auf meiner Schulter zappelte munter mit den Beinen. Ihre Fersen, die
sich dabei immer wieder in meine Haut bohrten, spürte ich nicht mehr als kleine
Nadelstiche.
Warum sie mir in die Höhle gefolgt war, war mir schleierhaft, da ich Feen in
Geschichten als himmel- und sonnennahe Wesen empfunden hatte.
Doch das sollte mich nicht weiter stören, denn insgeheim war ich dankbar für die
Anwesenheit der kleinen Fee. Sie gab mir eine gewisse Sicherheit, von der ich nicht
wusste, wo ich sie einordnen sollte.
Es dauerte nicht lange, bis der Tunnel in einen großen Hohlraum zu münden
schien. Ich erkannte nicht viel in der Dunkelheit, doch meine Schritte hallten von
Wänden wider, die weit entfernt wirkten. Ähnlich stellte ich mir den ersten Flug
eines Kükens vor, der bis zu diesem Zeitpunkt sein Nest nie verlassen hatte und sich
im nächsten Augenblick der endlos scheinenden Welt gegenübersah. Das Licht der
Fee schien im Anblick der schieren Größe der Felsengrotte abzunehmen.
„Sieh an, ein Mädchen verliert sich in meinem Geschichtenschatz.“ Ich erstarrte.
Mein Herz schien einen Satz aus meiner Brust zu machen. Es hätte mich nicht
gewundert, wenn ich es vor mir auf dem Steinboden hätte liegen sehen.
Die Stimme hallte von allen Seiten wider und dröhnte in meinem Kopf nach,
sodass ich sie nicht einordnen konnte. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte, da ich
in der Dunkelheit sowieso nicht dazu in der Lage war, überhaupt zwei Meter weit
zu schauen.
Die kleine Fee auf meiner Schulter summte leise vor sich hin. Sie schien nicht im
mindesten alarmiert zu sein.
Ich verkniff mir die Frage, um wen es sich bei der sprechenden Person handelte
und lauschte stattdessen auf das Atmen einer Person.
Doch das Einzige, was ich hörte, war Stille. Es kam mir so vor, als würde sie
unendlich laut von den Wänden widerhallen und mich dabei gleichzeitig in sich
einhüllen.
Plötzlich entflammte neben mir eine Fackel und ich schrie erschrocken auf. Immer
mehr von ihnen leuchteten auf. Ohne die Berichte, die ich an den Rat geschrieben
15
hatte, hätte ich das, was ich sah, im Nachhinein selbst nicht mehr beschreiben
können: Eine Bibliothek, wie sie noch niemand zu Gesicht bekommen hat und in
der ich jetzt meinen Brief verfasse. Sie ist gigantisch und gefüllt mit so vielen Karten
und Geschichten, dass ich sie nicht zu zählen vermag. Der Höhlenraum ist ebenso
riesig, sodass es mich nicht wundern würde, wenn er die Größe des Landes haben
würde. Die Regale scheinen kein Ende zunehmen, weshalb ich es kaum wage, mich
dort hineinzubegeben, aus Angst, ich werde mich in dem Labyrinth aus Büchern
verlaufen.
Bis heute war ich mir sicher, dass diese Formulierung dem, was mir gegenüber-
stand, kaum gerecht wurde. Doch an den Geruch konnte ich mich noch immer
erinnern. Er verfolgte mich in meinen Träumen: der Geruch nach Buchseiten, wie
man sie aus den Bibliotheken und Buchläden kannte, nur um einiges intensiver.
Einige Minuten lang war ich unfähig, mich zu bewegen. Ich starrte voller Ehr-
furcht in das Labyrinth aus Büchern. Mein Kopf versuchte das Bild verzweifelt
in irgendeinen Kontext zu bringen, doch von so etwas hatte ich noch nie zuvor
gehört.
„Was verschlägt dich in diese Gegend, Kind?“ Ich drehte mich erschrocken um.
Ein zerbrechlicher alter Mann mit langem, weißem Bart stand mir gegenüber,
gestützt auf einen holzigen Gehstock. So fragil wie er auch wirkte, seine hellen
grünen Augen stachen deutlich hervor.
Ich versuchte meine aufkommende Angst zu unterdrücken. Ohne Erfolg. Dabei
war ich eben aus jenem Grund hergekommen, das Land und dessen Bewohner
kennenzulernen.
„Ich grüße Euch. Mein Name lautet Mavis Baldwin. Ich bin Gesandte aus Vol-
kesland und gekommen, um dieses Land zu studieren“, versuchte ich so selbstbe-
wusst wie möglich zu sagen. Leider zitterte meine Stimme so sehr, dass es nicht
funktionierte.
„Sei gegrüßt, Mavis Baldwin aus Volkesland.“ Der Mann verbeugte sich tatsäch-
lich vor mir. Aus Reflex tat ich es ihm gleich. Dabei flog die Fee, die bis zu diesem
Zeitpunkt auf meiner Schulter gehockt hatte, zu ihm hinüber und ließ sich sum-
mend auf dessen Gehstock nieder.
„Willkommen in Istoria.“ Istoria. Dieses Fleckchen Land hatte tatsächlich einen
Namen. Ich musterte den Mann mir gegenüber. Auch er musterte mich und eine
unbehagliche Stille entstand.
Dann begann er zu sprechen: „Es ist lange her, dass sich ein Mensch aus deinem
Land hierhergewagt hat. Ich nehme an, dir ist nicht bewusst, wo du dich befindest,
Menschenkind.“ Zögernd schüttelte ich den Kopf und mein Herz begann noch
schneller zu schlagen. „Du stehst hier in der wandernden Bibliothek von Istoria.
Einem Ort, um den sich mehrere hundert Mythen ranken. Die Bücher hier seien
verflucht.“ Er schaute mich aufmerksam an.
„Inwiefern?“, verlangte ich zu wissen. Der Mann antwortete nicht.
„Du benötigst es, Kind.“ Ich starrte ihn an. Benötigen? Was?
„Tausende Geschichten. Tausende von Möglichkeiten. Eine Wahl, die zu treffen
verlangt wird.“ Er drehte sich um und verschwand in den Gängen der Bibliothek.
Perplex sah ich ihm hinterher.
Dass hier ein Zauber im Spiel war, war keine Frage. In Volkesland war ich bereits
des Öfteren mit Magie in Berührung gekommen. Ich selbst beherrschte keine. Und
die meiste Zeit konnte ich mich damit abfinden. Ich hatte ein angenehmes Leben.
Meine Familie lebte nur zwei Straßen weiter, ich arbeitete in einem kleinen Buch-
geschäft, traf mich regelmäßig mit engen Freunden und besaß selbst ein kleines
Haus.
Und dennoch verspürte ich diese dauerhafte Sehnsucht, wenn ich ein auf-
geschlagenes Buch vor mir hatte oder den unendlichen Himmel betrachtete. Es
fühlte sich egoistisch an, mehr zu wollen. Einzigartig zu sein, obwohl man sich nicht
beschweren konnte. Es gab Zeiten, da hatte ich mir gewünscht, todkrank zu sein,
nur um besonders zu sein. Um beachtet zu werden, auch wenn ich das theoretisch
nicht nötig hatte.
Und dann waren da diese Geschichten. Erzählungen von fernen Ländern,
fremden Kulturen und Abenteuern. Von längst vergangenen Zeiten und unterge-
gangenen Hochkulturen.
Manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich Bücher für ihren Zufluchtsort, den
sie mir boten, lieben oder sie für das stetige vor Augen führen meiner unwichtigen
Existenz verabscheuen sollte. Manchmal weckten sie eine solche Sehnsucht, dass
die Realität kaum auszuhalten war.
Meine Geschichte war wie jede andere auch. Unwichtig und lediglich ein mini-
maler Bestandteil einer ewigen Weltgeschichte. Es gab keine Geschichte, die noch
nicht erzählt worden war.
Vielleicht war es egoistisch, etwas Besonderes sein zu wollen. Eine Geschichte
zu schreiben, die einzigartig war. Und dennoch würde ich behaupten, dass es kein
Wesen auf der Welt gab, welches nicht danach strebte. Womöglich war das sogar der
Grund, warum es überhaupt dazu kam, dass sich die Geschichten immer aufs Neue
wiederholten. Ein Teufelskreis, verdammt für die Ewigkeit. Deprimiert ließ ich mich
auf den kühlen Boden fallen. Die Fee summte leise um mich herum, als wolle sie
mich zum Aufstehen ermuntern. Doch der Hoffnungslosigkeit, welche mich auf
einmal überkam, konnte sie mit ihrem Gesumme nicht entgegenwirken.
17
Dann sah ich ein Buch aus dem nahegelegensten Regal fallen. Ich starrte es an.
Lediglich um sicher zu gehen, schaute ich mich um, doch wie zu erwarten, sah ich
keine Menschenseele. Langsam erhob ich mich und ging auf das Buch zu. Als ich
nur noch wenige Schritte entfernt war, fing es an zu leuchten und schlug mit einem
lauten Knall auf. Erschrocken und mit weit aufgerissenen Augen wich ich zurück.
Die Seiten schlugen selbstständig immer schneller um, während es heller leuch-
tete. Ich schloss die Augen. Ich kniff sie so fest zusammen, dass es beinahe wehtat.
Ich hörte lediglich meinen schnellen Atem, der nicht langsamer werden wollte.
Dann hörte ich die Vögel. Und das Rauschen der Blätter. In der Ferne hörte ich
einen reißenden Fluss, der gigantisch sein musste. ‚Sane‘, schoss es mir durch den
Kopf. Der Name des Flusses. Es war ein Fluss aus einem meiner Lieblingsbücher
Die Reisen der Daphne.
„Daphne!“ „Hey Daphne. Hörst du mich?“ Sie öffnete die Augen. Lachend setzte sie sich
auf, als sie Nolan näherkommen sah.
„Müssen wir schon weiter?“, fragte Daphne seufzend.
„Ganz genau, du Tagträumerin. Der Prinz wartet nicht gern“, entgegnete Nolan grinsend
und half ihr hoch. Daphne verdrehte die Augen. Prinz Elias gab ihnen so viel Zeit, wie sie
benötigten, um Informationen zusammenzutragen. Laut eines Spions plante der Rat eine
Intrige gegen Elias’ Vater, den König. Sollte der König dabei sterben, würde die gesamte
Demokratie, die über die letzten Jahrzehnte unter großem Blutvergießen geschaffen wurde, in
sich zusammenfallen. Daphne mochte nicht an die Erzählungen aus der Zeit davor denken.
Unterdrückung und Gewalt beherrschten das Volk von Venzor.
Daphne selbst hätte laut den Idealen der alten Welt auf Grund ihrer Abstammung keinen
Platz in diesem Land verdient. Auch viele andere würden den Umbruch sicher nicht über-
leben. Umso wichtiger war es, dass sie als Omada, einer geheimen Organisation, die dem
Prinzen direkt unterstellt war und für Sicherheit im gesamten Land sorgte, einen Angriff
verhindern mussten.
Entschlossen schwang Daphne sich auf ihr Pferd und folgte ihrem besten Freund zurück in
die Stadt, um sich mit den anderen zu treffen.
Lachend preschten sie dabei durch den Wald. Daphne genoss das Lachen ihres Freundes
und den Wind in ihrem Gesicht. Das Gefühl von Freiheit, welches sie beim Reiten so liebte,
durchströmte sie. Während sie dem Weg folgten, wurden sie immer schneller, bis die Baum-
stämme um sie herum nur nach als Schemen zu erkennen waren und der Himmel über
ihnen hinweg zog.
Doch nach einiger Zeit kamen die weitgeöffneten Stadttore in Sicht und sie mussten ihr
Tempo zügeln. Schwer atmend verfielen Daphne und Nolan in den Schritt. Ihre Wangen
waren vom Wind gerötet und ihre Haare verfilzt. Von den Blicken der Wachen ließen sie sich
18
jedoch nicht stören und ritten, noch immer vom Adrenalin durchströmt, durch das Tor.
„Nur um das klarzustellen: Ich war eindeutig schneller als du“, posaunte Nolan neben ihr
und biss herzhaft in seinen Apfel, den er sich aus der Satteltasche gezogen hatte.
„Das glaubst auch nur du“, erwiderte Daphne schmunzelnd.
Zufrieden ritten sie durch die Straßen der lebhaften Stadt. Hier und da blieben sie stehen,
um mit Bekannten und Freunden zu reden oder sich eine Erfrischung am Brunnen zu
genehmigen.
Doch als sie am vereinbarten Treffpunkt ankamen, legte sich ihre Laune. Schweigend
stiegen sie ab und banden die Pferde an der Tränke an, um auch sie mit Wasser zu versorgen.
Sie betraten den Hinterhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Von da aus gelangten
sie in einen unscheinbaren Salon, dessen Geheimtür in der Abstellkammer jedoch in ein
imposantes Kellergewölbe führte. Sie versicherten sich mehrmals, dass ihnen keiner gefolgt
war, bevor sie in die Kammer schlüpften und der Treppe hinunter folgten.
Mehrere Personen hatten sich auf dem Teppichboden versammelt. Vor ihnen standen
unangerührte Getränke und Speisen. Daphne folgerte daraus, dass es keine positiven Nach-
richten auszutauschen galt.
„Wenn wir dann vollständig sind, lasst uns beginnen“, erklärte Elias, der hinten an der
Wand lehnte.
„Leo fehlt noch“, erwiderte Nolan und setzte sich ebenfalls. Niemand antwortete. Daphne
hielt in ihrer Bewegung inne und sah in Elias’ versteinertes Gesicht.
„Es tut mir leid.“ Seine Stimme klang heiser. Doch Daphne wollte es nicht wahrhaben. Sie
hatte vor einigen Stunden noch mit Leo gesprochen. Sie hatten sich über belanglose Witze
seinerseits unterhalten und ein wenig herumgealbert. So wie sie es seit ihrer Kindheit getan
hatten und auch in Zukunft tun würden.
Tränen traten ihr in die Augen. Ihre Kehle begann bei dem Versuch, das Schluchzen zu
unterdrücken, zu schmerzen. Alles begann zu schmerzen. Luftschnappend ging sie zu Boden.
Tränen tränkten ihr Gesicht und Schmerzen zerrissen ihre Brust. Die Stimmen überschlugen
sich in ihrem Kopf und eine Machtlosigkeit und Erschöpfung, wie sie sie noch nie erlebt hatte,
überkamen sie. Elias und Nolan waren auf der Stelle bei ihr.
„Daphne, es tut mir so leid. Vielleicht, vielleicht hätte ich“, setzte Elias an, doch Daphnes
verzweifelter Schrei unterbrach ihn.
„Was hast du getan?“, flüsterte sie am Boden. Elias zitterte. Seine Augen glänzten vor
Kummer. „Es tut mir leid“, flüsterte er nur wieder.
„Was hast du getan?“, fragte sie beinahe teilnahmslos und setzte sich langsam auf. Elias
schluckte, sah ihr jedoch fest in die Augen, als er zu sprechen begann.
„Er wusste, was für ein Risiko es war, sich in das Haus des Ratsvorsitzenden zu schleichen,
Daphne. Sie müssen uns auf die Schliche gekommen sein. Er war ein starker Mann. Er hat
gekämpft.“
19
Seine Stimme wurde, während er redete, immer leiser, bis sie kaum noch zu verstehen
gewesen war. Daphne wollte einen Ton hervorbringen. Irgendetwas sagen. Doch es war
ihr nicht möglich. Würde sie den Mund öffnen, so wusste sie, würde ihre Trauer kein Ende
finden.
„Was haben sie ihm angetan?“, fragte Nolan an ihrer Stelle. Sein Gesicht war genauso von
Trauer gezeichnet. Elias’ Blick wandte sich nun ihm zu. Der Rest der Gruppe starrte betreten
und in eigenen Gedanken versunken auf den Boden.
„Sie haben ihn gefoltert“, antwortete er. Auch wenn er es zu überspielen versuchte, zitterte
Elias’ Stimme.
„Gefoltert?“, fragte Amren am anderen Ende des Raumes bitter. „Wohl eher verstümmelt.“
Elias schloss die Augen.
„Wie der Prinz bereits sagte, wir wussten alle, auf welches Risiko wir uns einlassen.“ Die
Stimme des Mannes, welcher sich in das Gespräch eingemischt hatte, klang unbekümmert.
Daphne verstand nicht, wie ein Mensch so wenig Mitgefühl für einen Kameraden erübrigen
konnte, wenn sie doch alle füreinander sterben würden. Zumindest war Daphne davon
ausgegangen.
„Deswegen muss man niemanden in den Tod schicken“, knurrte Amren.
„Wieso hast du ihn gehen lassen, Elias?“, flüsterte Daphne. Sie traute sich nicht zu lauter
zu sprechen.
„Du hast ihn sterben lassen“, flüsterte Daphne. „Du hast ihn sterben lassen“, schrie sie und
sprang auf. Sie wusste nicht, woher diese Wut kam. Sie wusste nur, dass sie so intensiv und prä-
sent in ihr wütete, dass sie kaum noch die anderen Menschen um sich herum wahrnahm.
Sie hatte so viel durchgestanden. Sie hatte sich von ihrem Mann abgewandt und war
selbstständig geworden. Sie hatte sich als Frau bewiesen und in einer Welt, in der Männer
herrschten, überlebt. Und Leo war ebenso wie Nolan und Amren immer ein Teil davon
gewesen. Der Gedanke des klaffenden Lochs, den er in dieser Welt hinterlassen hatte, konnte
sie nicht ertragen.
Daphne musste aus diesem stickigen Keller. Übelkeit stieg in ihr hoch und sie rannte.
Rannte die Treppen hinauf. Auf die Straße, die noch immer in bunten Farben strahlte und
auf der sich Leute glücklich miteinander unterhielten. Glück. Daphne wusste in diesem
Moment nicht einmal mehr, was das eigentlich war. Ihr Blick verschwamm und ehe ich mich
versah, starrte ich an die dunkle Höhlendecke.
Tränen rannen mir über das Gesicht und ich bekam keine Luft. Am ganzen
Körper zitternd, versuchte ich, mich aufzusetzen, um mich zu orientieren. Doch es
dauerte eine ganze Weile, bis ich mir zutraute, nicht erneut zusammenzubrechen.
Erst dann gestatte ich meinen Gedanken, zurück zu Daphne und ihren Freunden
zu wandern.
20
Ich starrte das Buch vor mir an. Die Reisen der Daphne. Die aufgeschlagene
Seite berichtete von dem Verlust, den die Protagonistin durchlebte. Wie sie, ohne es
wahrzunehmen, zum Haus des Ratsvorsitzenden eilte und ihn letztendlich ermor-
dete. Der Tod von Leo war der dramatische Wendepunkt gewesen, der das Buch
damals so spannend gemacht hatte. Jetzt gruselte ich mich etwas vor mir selbst.
Warum duldete man in Büchern Kriege, Kämpfe und Intrigen und las über den Tod
von Charakteren, im realen Leben hingegen würde man es verabscheuen? Warum
faszinierten uns solche dunklen Geschichten so sehr? Ich hatte es immer damit
erklärt, dass es mich ablenkte. Dass es für Spannung sorgte, wo es in meinem Leben
nur Eintönigkeit gab. Doch wo waren wir gelandet, wenn wir Kriege brauchten, um
uns von einer Welt abzulenken, in der es diese zu genüge gab?
Ich fasste mir an die Brust. Es war, als würde ich den Schmerz des Verlusts, den die
Frau ertragen hatte, in mir spüren. Diese Verzweiflung, von der ich glaubte, sie beim
Lesen verstanden zu haben, nahm mir fast die Luft zum Atmen.
Ich hob das Buch vorsichtig auf. Ich wagte es nicht, darin zu blättern. Was auch
immer das für ein Ort sein sollte, es war bizarr. Ich hatte noch nie von einer Magie
gehört, welche Wesen in Geschichten aufnehmen konnte. So stellte ich es mir
zumindest vor.
Meine Neugier war geweckt. Was versteckte sich hinter all diesen Büchern? Wie
funktionierte es? Sollte ich es wagen, noch ein weiteres Buch aufzuschlagen?
Aus dem Augenwinkel kam die Fee klingelnd auf mich zu. Aufgeregt schwirrte sie
um meinen Kopf herum und spendete mir damit das nötige Licht. Die Fackeln, die
vereinzelt angebracht waren, halfen nur notgedrungen.
Lächelnd stellte ich das Buch zurück in das Regal und bestaunte die anderen
Bücher. Es schien in dieser Bibliothek keine Ordnung zu geben. Weder nach
Alphabet noch nach Größe oder Textart konnte ich mich orientieren, weshalb mir
nichts anderes übrigblieb, als den Regalen in den hinteren Teil der Höhle zu folgen.
Doch diese schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann blieb ich stehen, aus Angst,
ich würde mich in diesem Labyrinth aus Regalen verirren, wenn ich noch tiefer
hineinging.
Mein Blick fiel auf ein dickes Buch mit vergoldetem Einband. Vorsichtig zog ich
es aus dem Regal und pustete die Staubschicht herunter. Der Weg des Kampfes. Ich
schmunzelte. Dieses Buch hatte ich vor einigen Wochen regelrecht verschlungen,
weil es eines der ersten Bücher war, dass einen weiblichen Protagonisten besaß. Vor
der Reform war das anders gewesen.
Der Weg des Kampfes handelte von dem weitentfernten Königreich Arkadia.
Die Protagonistin Aideen war eine Kriegerin, welche zum Schutz der Prinzessin
Poloma abgesetzt wurde. Denn dessen Schwester Themis war entführt worden.
21
Man ging von einem Putsch aus, doch letztendlich entwickelte sich ein Krieg mit
dem verfeindeten Nachbarland. Mit den zahlreichen unerwarteten Wendungen,
welche mir das Buch beschert hatte, war es zu einem meiner Lieblingsbücher
geworden. Begeistert blätterte ich an das Ende des Buches. Ich wollte nicht erneut
den Schmerz, wie ich ihn als Daphne vernommen hatte, spüren. Denn das Ende
des Buches war von zahlreichen Festen nach einem langandauernden Krieg geprägt
und fast ausschließlich positiv beschrieben. Nach dem letzten Buch konnte ich dies
eindeutig brauchen. Vorsichtig schlug ich die letzte Seite auf. Wie zuvor auch leuch-
tete das Buch in einem hellen Licht auf, sodass ich die Augen fest zusammenkneifen
musste.
Das Feuer spiegelte sich in ihren Augen. Sie wartete auf die Tränen, doch sie kamen nicht.
Vielleicht hatte sie bereits zu viel verloren, um jetzt noch die Kraft zum Weinen zu haben.
Sie dachte an Poloma und Conrad. An die Bürger von Elisor, welche den unerwarteten
Angriff der feindlichen Gruppen nicht überlebt hatten. Sie dachte an die unzähligen Kinder,
die nun ohne Vater aufwachsen mussten. Väter, die in diesem Feuer brannten. Nicht einmal
eine Beerdigung wurde ihnen mehr gegönnt, um sich verabschieden zu können. Sie hätte noch
Unmengen mehr Opfer dieses Krieges aufzählen können, doch zu ihrem eigenen Schutz tat
sie es nicht.
Am meisten schmerzte Vedas Verrat. Wo auch immer sie sein mochte, Aideen wusste, dass
sie ihre Freundin verloren hatte. Womöglich schon lange vor diesem Kampf, auch wenn sie es
nicht wahrhaben wollte.
„Aideen, du verpasst die Feier.“ Themis lächelte sie glücklich an. Sie trug seit langem wieder
einen Blumenkranz im Haar. Und ihr Kleid war in einem sanften Blauton gehalten. Nicht
mehr schwarz, um zu trauern. Doch Aideen ließ sich nicht täuschen. Egal wie bunt sie sich
kleidete, Themis war nicht über die Trauer hinweg, den der Tod ihrer Schwester Poloma ihr
bereitet hatte. Sie konnte es nur deutlich besser verstecken als Aideen.
„Wie kannst du das nur?“, fragte Aideen leise. Themis’ Lächeln verschwand.
„Wir sind es ihnen schuldig, glücklich zu sein. Was bringt uns ein Sieg, wenn wir mit ihm
nichts anfangen?“, erwiderte sie nach einer Weile.
„Ist es das denn? Ein Sieg?“
Was machte ein einziger Sieg im Verhältnis von tausenden Verlusten?
„Ja“, antwortete Themis nach kurzem Schweigen. „Versteh mich nicht falsch, ich kenne die
Zahlen der Gefallenen und ich weiß auch, dass es unzählige Trauernde gibt. Letztendlich
sind wir alle Opfer des Krieges.“ Sie holte zitternd Luft. „Aber hast du die Kinder gesehen,
die im Fluss gespielt haben? Oder die Frauen, die gerade durch den Ballsaal tanzen? Oder
der Wald, der wieder blüht? Es bringt uns nichts, wenn wir den Toten hinterher trauern oder
uns nur um die Zukunft sorgen, Aideen. Die Menschen und die Natur beginnen sich zu
22
erholen. Und wir haben es genauso verdient. Also komm mit zu den anderen. Sie vermissen
dich.“ Aideen wusste, dass sie nicht nur ihre Abwesenheit auf dem Fest meinte. Der Krieg war
nun schon seit drei Monaten vorüber. Sie hatte das Gefühl gehabt, seit drei Monaten tot zu
sein. Nachts träumte sie von den Schreien. Dem vielen Blut und von Conrad. Vor allem von
Conrad. Und tagsüber? Tagsüber wurde sie in allem daran erinnert, was sie verloren hatte.
Während des Krieges hatte sie sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als diese stetige
Ungewissheit und Angst. Doch niemand hatte sie darauf vorbereitet, dass das Danach noch
viel schlimmer war. Dieser andauernde Schmerz und die Wut, die einfach nicht von ihr wei-
chen wollte.
Aideen starrte auf das Feuer, in dem die Toten brannten, welche an diesem Tag geborgen
wurden. Jeden Tag fanden sie auf dem verlassenen Schlachtfeld Tote. Um Krankheiten und
Massengräber zu vermeiden, wurden sie verbrannt.
„Okay.“ Themis blinzelte kurz erstaunt. Doch dann lächelte sie und nahm Aideen bei der
Hand. Schweigend führte sie sie zurück. Zurück zu ihrer Familie.
Als ich erwachte, liefen mir die Tränen stumm die Wangen hinab. Erneut über-
fielen mich die Emotionen. Ich versuchte mir einzureden, dass es sich lediglich um
eine Geschichte handelte. Dass es völlig sinnlos war, deswegen Tränen zu vergießen.
Doch ich wusste, dass es anders war.
Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und rappelte mich auf. Die Höhle
sah noch genauso aus wie zuvor. Durch das Licht, welches die kleine Fee noch
immer spendete, fielen die riesigen Schatten der Regale auf mich. Doch ich nahm
sie nicht als bedrohlich wahr. Ganz im Gegenteil. Sie lösten ein tiefes Gefühl von
Geborgenheit und Erkenntnis in mir aus.
„Du hast es also vollbracht, Menschenkind“, ertönte die Stimme des alten
Mannes. Ich drehte mich zu ihm um. Er lächelte zufrieden.
„Was ist dies für ein Ort?“, fragte ich erneut. Der alte Mann schmunzelte.
„Ein Tor zu den verschiedensten Geschichten und Welten.“
„Warum in einer Höhle?“, wollte ich weiterwissen.
„Oh, eventuell wird sie als nächstes als alte Ruine erscheinen. Das kann man nicht
vorherbestimmen.“
„Und wozu? Wozu bin ich hier?“ Meine Stimme zitterte leicht.
„Ich denke, diese Frage kannst du dir mittlerweile selbst beantworten. Ich bin hier,
um dich zu warnen. Verlass die Höhle so schnell du kannst. Nachdem sie ihre Auf-
gabe erfüllt hat, wandert sie weiter.“ Sie? Redete er von der Bibliothek?
Ein Beben ließ die Regale um mich herum wackeln und ich zuckte erschrocken
zusammen. Ich drehte mich zu dem alten Mann um, doch er war bereits ver-
schwunden. Panisch suchte ich nach der kleinen Fee. Diese machte mich klingelnd
23
auf sich aufmerksam, da sie bereits Richtung Ausgang geflogen war. Ich zog meinen
Mantel enger um mich und rannte ihr hinterher. Das Beben wurde immer laute-
rund der Boden begann zu schwanken. Ich stolperte mehrere Male, bevor ich mein
Gleichgewicht wiederfinden konnte.
Feiner Sand bröselten auf mich herab. Entsetzt starrte ich an die Decke. Risse
bildeten sich dort und zogen sich über die gesamte Höhle. Verdammt. Ich zwang
meine Beine dazu, schneller zu laufen, wobei ich darauf vertraute, dass mir die Fee
den richtigen Weg wies, denn ich hatte jegliche Orientierung verloren.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich den Ausgang erreicht hatte. Ich hastete
den Gang hinauf, ohne die Wandmalereien eines weiteren Blickes zu würdigen.
Meine Erleichterung war grenzenlos, als ich das Sonnenlicht am Ende des Ganges
erblickte. Schwer atmend ließ ich mich auf dem weichen Grasboden nieder und
holte schnappend Luft. Mein ganzer Körper zitterte vor Anstrengung. Doch ich
hatte es geschafft. Erschöpft rollte ich mich auf den Rücken und schloss die Augen.
Das Klingeln der Fee verriet mir, dass auch sie es sicher geschafft hatte.
Meine Gedanken wanderten zurück zu Aideen und Themis. Eigentlich war ich
davon ausgegangen, dass ich mich auf einem fröhlichen und ausgewogenen Fest
vergnügen würde. Stattdessen hatte ich mich erneut in einer trauernden Person wie-
dergefunden. Das es an mir lag, glaubte ich nicht. Vielmehr fragte ich mich, ob die
Protagonistinnen in ihrer Einzigartigkeit tatsächlich das perfekte Leben führten. Ob
sich ihre Geschichten so sehr von meiner eigenen unterschieden? Gehörte nicht
zu jedem Leben Angst, Schmerz, Verzweiflung, Trauer und Unsicherheit? Genauso
wie Freude und Liebe waren sie ein stetiger Begleiter in jeder Geschichte. In jedem
Leben. Sie machten das Leben weder besser, noch schlechter. Sie machten es ganz
einfach lebenswert. Sie sorgten dafür, dass man Erfahrungen und Fehler machen
konnte. Und jeder ging einzigartig aus diesen hervor. Jeder auf eine andere Weise
und zu einem anderen Zeitpunkt. Ich lächelte. Ich wusste nicht, ob es das war, was
die wandernde Bibliothek von Istoria mir sagen wollte. Doch ich war stolz, diese
Erkenntnis erlangt zu haben. Ich öffnete die Augen und blickte in ein wunder-
schönes und einzigartiges Bild aus Himmel und Wolken. So, wie sie sich ständig
veränderten, veränderten auch wir uns.
Letztendlich war das Leben wie ein Buch. Einige Kapitel waren traurig, einige
waren voller Freude und andere waren aufregend. Doch wenn man die Seiten nie-
mals umschlug, würde man nie erfahren, was das nächste Kapitel für Abenteuer
bereithielt.
Ich dachte an die zahlreichen Lebewesen in Volkesland, die alle dabei waren,
ihre eigene Geschichte zu schreiben. Es gab also noch unzählige Geschichten und
Kapitel, die darauf warteten, gelebt zu werden.
VOLKESLAND
Aufbruch ins Unbekannte
Eine Gemeinschaftsproduktion von Markus Heitz und der Schreibwerkstatt der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ Berlin, Marzahn-Hellersdorf unter Leitung von Renate Zimmermann
Illustrationen: Isabell Geger, Antje Püpke, Annika Baartz, Vivienne Pabst, Tim Gärtner
Herausgeber: Förderverein Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf e.V. und Renate Zimmermann
www.marzahner-promenade.berlin jetzt auch auf Instagram