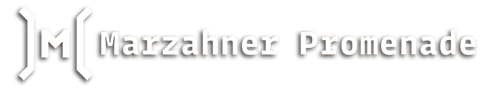Tulpen aus Amsterdam - einstmals teurer als Gold

20.03.25 Tulpen, die Frühlingsblüher, gibt es jetzt überall billig zu haben, im Supermarkt, im Blumenladen. Man kauft sie, stellt sie in die Vase, erfreut sich daran. Tulpen haben eine besondere Geschichte. Vor allem die Tulpen aus Amsterdam.
Portas Renovierungen, MP 37, hat wieder eine schöne Schaufenstergestaltung. Eine Große Vase mit riesigen Tulpen, darum rankt ein grünes Tuch, lässt Platz für weiteren Nippes. Ein schönes Frühlingsschaufenster.
Tulpen aus Amsterdam - Lied
Wenn man aber stehen bleibt und näher hinschaut, kommt einem schnell der Gedanke an „Tulpen aus Amsterdam“. Eine Melodie erklingt leise im Gedachtnisohr, einstmals gesungen von … nun, es gibt viele Interpreten.
Der deutsche Schauspieler und Interpret Günter Neumann schrieb das Lied im Jahr 1953 nach einem Auftritt im Amsterdamer Tuschinski-Theater, nachdem er die Tulpenfelder in Keukenhof besichtigt hatte.
Kurz danach schrieb er die ersten Liedverse, sein Herausgeber war jedoch nicht sehr angetan und so unterblieb zunächst eine weitere Verwendung. 1956 bemerkte der Liederschreiber Ernst Bader den Text und schrieb ihn um.
Er fragte den Komponisten Arthur Niederbremer (der unter den Pseudonymen Dieter Rasch und Ralf Arnie arbeitete) und dieser vertonte das Lied, inspiriert durch den „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite.
Ursprünglich war diese erste Version für den Schlagersänger Gerhard Wendland vorgesehen, die erste Aufnahme erfolgte jedoch 1956 zugleich in der deutschen und niederländischen Version (Tulpen uit Amsterdam) durch den belgischen Sänger Jean Walter. Der Text der niederländischen Version stammt von Jos Dams und Leo Camps.
Die Version wurde ein Hit in Europa, 1957 gab es eine englische Version durch Gene Martyn, gesungen von dem englischen Unterhaltungskünstler Max Bygraves.
Das Lied wurde mehrfach interpretiert, eine der bekanntesten Versionen ist von Mieke Telkamp von 1959.
Zehn Jahre später kam es von Wilma Landkroon heraus. 1970 sangen der niederländische Entertainer Rudi Carrell und der Kinderstar Heintje eine parodistische Version des Liedes, bei der die große Anzahl von Unterhaltungskünstlern aus den Niederlanden thematisiert wird, die in Deutschland tätig sind („Nulpen aus Amsterdam“).
1974 erschien eine Aufnahme von Roy Black und den Fischer-Chören. Das Lied erklang in der Münchner Allianz Arena, wenn der niederländische Fußballer Arjen Robben für den FC Bayern München ein Tor schoss.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Tulpen_aus_Amsterdam
Ttulpenmanie
Die Tulpen aus Holland haben eine noch spektakulärere Geschichte.
Im 17. Jahrhundert erlebten die Niederlande die verrückteste Spekulation der Weltgeschichte
Für ungefähr dreieinhalb Jahre, zwischen Sommer 1633 und Anfang 1637, waren die Bürger der stolzen Republik völlig verrückt nach Tulpenzwiebeln.
Viele Sorten der unscheinbaren, wenige Gramm schweren Knollen wurden für die zehn- bis hundertfache Menge an Gold gehandelt, manche gar so teuer wie Häuser in bester Innenstadtlage Amsterdams. Die Preise stiegen bis zum 5. Februar 1637 stetig.
Mindestens 2000 Gulden kostete eine Zwiebel der Sorte Semper Augustus im Jahr 1630, eine besonders schöne Tulpe, mit langem schlankem Stängel und unregelmäßig gestreiftem, sogenannten geflammtem Kelch - achtmal so viel, wie ein Zimmermann im Jahr verdiente.
Die Preise kletterten weiter. Im Juni 1633 wurde in der Hafenstadt Hoorn erstmals ein ganzes Haus für nur drei Tulpenzwiebeln verkauft – dieser Handel gilt als eigentlicher Beginn des Tulpenwahns.
Es entwickelte sich eine neue Branche: Kataloge, Alben und Flugschriften über nichts anderes als Tulpen. Es war der erste Boom von Wirtschaftsmagazinen in der Weltgeschichte.
Die Flugschriften brachten immer mehr Holländer dazu, Geld in den Markt zu pumpen.
Für eine normale 250 Azen (Gewichtseinheit) schwere Tulpenzwiebel konnten je nach Sorte im Sommer 1636 zwischen fünf und 2500 Gulden bezahlt werden. 250 Azen Gold kosteten damals etwa 16 Gulden.
Auch an sich wertlose einfache Tulpensorten kamen auf den Markt. Selbst sie fanden von Herbst 1636 an reißenden Absatz.
Niemand konnte oder wollte sich vorstellen, dass der Markt überhitzen könnte. Selbst die Zwiebeln von Allerweltstulpen wie die Switsers wurden teurer als Gold gehandelt. Ein besonders schönes Exemplar der Gouda etwa 3750 Gulden – so viel wie ein Pfund Gold.
Doch am 5. Februar 1637 fand sich kein einziger Käufer mehr, der die aufgerufenen Preise für einige Posten Zwiebeln zahlen wollte. In den folgenden Tagen brach der Kurs um 95 Prozent ein.
Von einem Tag auf den anderen brach der Markt ein. Zurück blieben zerstörte Existenzen und nie zuvor gekannte Schuldenberge.
Anne Goldgar: „Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age“. (University of Chicago Press 2007. 446 S., 24,95 Euro).


Die begehrteste Tulpe der Welt, Bild: Zeitgenössisches Aquarell (17. Jahrhundert) einer Tulpe der Sorte Semper Augustus, Norton Simon Museum in Pasadena

Portas Schaufenstergestaltung. Fotos: Uta Baranovskyy

Diese Windmühle aus Delfter Porzellan ist eine Spieluhr und spiel die Melodie - na? - "Tulpen aus Amsterdam".
Delfter Keramik
oder Delfts aardewerk ist eine dekorlose oder von Hand bemalte (zinnlasierte) Keramik, die in Delft hergestellt wurde.
Im Lauf des 19. Jahrhunderts gab die Zinnlasur den Weg frei für weiß ausbrennende Keramik, die mit den traditionellen Verzierungen nun auch bedruckbar wurde. Delfts aardewerk wird weltweit geschätzt als ein Nationalprodukt und hat einen ähnlich hohen Stellenwert wie die alt-niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts begann die Verenigde Oost-Indische Companie (VOC) gut durchorganisiert chinesisches Porzellan in großen Mengen zu importieren.
Sofort begann man in verschiedenen Städten der Niederlande diese exotisch anmutenden Vorbilder zu imitieren.
Es gelang zuerst in Delft, einen Ersatz aus hochwertiger zinnlasierter Keramik zu erfinden, die dem Erscheinungsbild von Porzellan sehr nahekam. Durch die große Nachfrage nach dem „holländischen Porzellan“ wurde dieser Zweig zu einem wichtigen Pfeiler der Delfter Wirtschaft.
1625, einige Jahre nach der Erfindung des Delfts aardewerk, stellten alle acht vorhandenen Tellerbrennereien um auf dessen Produktion. Die Zahl der Brennereien nahm zu auf 31 bis ins Jahr 1675.
Aus der Produktion mehrerer Millionen Stücke pro Jahr resultierte ein Absatzgebiet, das bis nach Curaçao und Boston reichte.
Neben der Konkurrenz zwischen chinesischem und europäischem Porzellan stellte der Import der härteren und billigeren english creamware ab Mitte des 18. Jahrhunderts die größte Bedrohung dar. Der Verfall setzte ein, und von 24 aktiven Brennereien im Jahr 1750 existierten um 1800 nur noch 10. Heute ist nur noch De Porceleyne Fles in Betrieb.
Die Delfter Tellerbäcker hatten großen Erfolg mit ihren Imitationen chinesischen Porzellans, ihre vom Äußeren her vergleichbare Ware produzierten sie konkurrenzlos günstig.
In einer der 6 Kammern der VOC in Delft war als Vorlage sehr viel Porzellan vorrätig. Durch die Schließung von Bierbrauereien innerhalb der Stadt wurden viele Betriebsgebäude frei, die die „Tellerbäcker“ beziehen konnten.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Delfter_Keramiken

Frühlingsschaufenster
Neben Portas haben sich auch andere Schaufenster in der Marzahner Promenade schon ein Frühlingskleid angezogen. Wie zum Beispiel der Marzahner An- und Verkauf, MP 42.
Wie beim vergangenen M-Promi-Promenadenfrühstück besprochen, findet demnächst wieder eine Osteraktion statt, bei der Kinder in beteiligten Geschäften kleine Holzostereier und - Hasen abholen können, zu Hause bemalen und wieder hinbringen.
Dafür bekommen sie eine kleine Osterüberraschung, gesponsert von degewo. Diese bemalten Kunstwerke sollen anschließend in die Schaufenster gehängt werden.
Dann gehen die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern vorbei und zeigen und freuen sich über ihre Werke
Sehr begrüßenswert wäre es, so Promenadenmanager. degewo, wenn sich auch die anderen Schaufenster mit Frühlingsdekoration an der Verschönerung der Promenade beteiligten.

Marzahner An- und Verkauf mit Frühlingsdekoration.

Lustiges Küken.

Bienchen summ.

Frühlingsgefühle