11.02.24 Auch im vergangenen Jahr schrieben die Mitglieder der Schreibwerkstatt für Jugendliche der Mark-Twain-Bibliothek einen Roman zusammen. Und wie schon im vergangenen Jahr wird es hier an dieser Stelle jeden Sonntag daraus eine Fortsetzungsfolge geben. Heute zu lesen von Cassy das vierte Kapitel ALLABASTYE:
Viertes Kapitel
COSMIA UND VANDA
„Du kannst nicht gehen, Vanda.“ Meine Mutter hatte die Hände in die Hüften
gestellt und sah mich ernst an.
„Mutter, wie oft hatten wir die Diskussion schon? Ich bin alt genug. Wenn ich
Ritter werden kann, schaffe ich das doch mit Leichtigkeit.“ Die Erinnerung an
beinahe dasselbe Gespräch vor einigen Jahren ließ mich schmunzeln, was meine
Mutter überhaupt nicht witzig fand.
„Wie willst du überhaupt dahin kommen? Wir können uns nicht mal einen Esel
leisten.“
„Dann laufe ich eben, ist doch egal. Freust du dich denn gar nicht für mich?
Immer sagst du nur, wie sehr ich hier fehlen werde. Aber es ist Zeit für mein eigenes
Leben. Ich wünsche mir, dass du das akzeptierst. Du bist schrecklich alt geworden.“
Damit hatte ich sie geknackt, auch wenn sie es nie zugeben würde. Ich war mir wohl
bewusst, wie sehr sie darunter leiden musste, ihr kleinstes Küken das Nest verlassen
zu sehen. Andererseits hatte ich nie vorgehabt, mich dem wohlbehüteten Leben
meiner Familie anzuschließen. Meine ältesten Geschwister waren Bauern, Hand-
werker oder Hausfrauen, hatten bereits früh geehelicht und größtenteils schon
Kinder. Aber das passte doch, da hatte meine Mutter jemanden zu betutteln.
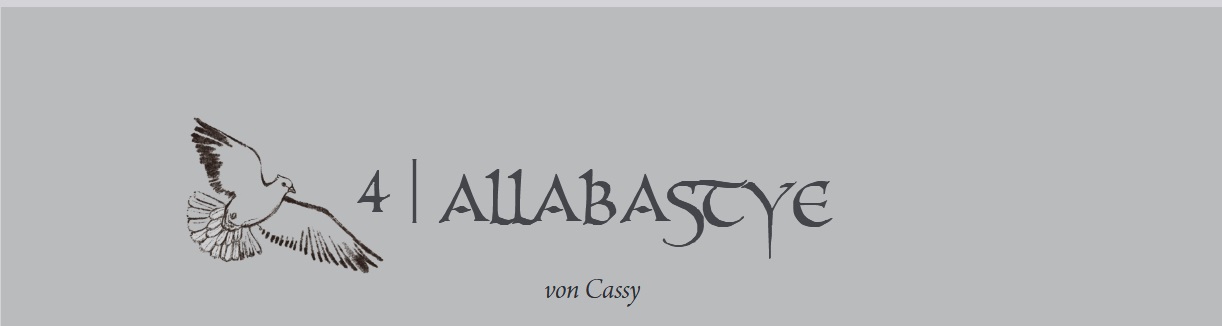

Illustration: Isabell Geger, Antje Püpke, Annika Baartz, Vivienne Pabst, Tim Gärtner
.
Ich war schon immer anders als der Rest der Familie. Mein Vater hatte für mich
eine Handwerkerlehre vorgesehen, doch ich wollte der Gesellschaft auf anderem
Wege dienlich sein. Ich ging an den Hof und wurde Ritter. Seit dem Sturz der
Königsfamilie hielt ich mich wieder überwiegend im Elternhaus auf, da noch nicht
entschieden wurde, was aus dem Heer werden sollte. Ich war also bereit für ein
neues, für ein richtiges Abenteuer.
Am Abend vor Beginn der großen Reise packte ich meine sieben Sachen. Allzu
viel konnte ich nicht mitnehmen, immerhin hatte ich keinen Packesel dabei. Aber
selbst, wenn es mir an etwas mangeln sollte, so hatte ich es bis nach Hause nicht
weit. Der Rat hatte mir ein direktes Nachbarland zugeteilt und nur in 80 Stunden
Fußmarsch sollte ich die Grenze überquert haben. Das war im Vergleich zu anderen
Märschen, die ich schon bestritten hatte, eine sanfte Tour.
67
Als ich alles eingepackt hatte, Proviant, Feder, Tinte, Pergament, blickte ich
mich noch einmal in meinem Zimmer um. Lange Zeit hatte ich es mir mit einigen
Geschwistern teilen müssen, doch seit ungefähr zwei Jahren war es nun meins. Das
Zimmer würde wieder für eine Weile leer stehen. Doch das würde mich nicht von
der Reise abhalten.
Ich setzte mich in den Sessel unterm Fenster und badete in dem hereinfallenden
Mondlicht, als es plötzlich hinter mir klopfte. Als ich mich umdrehte, saß draußen
auf dem Fenstersims eine Taube, die aufgeregt ihren Kopf hin und her wiegte. Sie
sah ungewöhnlich aus. Ihr Körper war nicht wie üblich weiß, sondern braun, nur die
Flügel waren hell. An ihrem linken Bein hing ein zusammengerolltes Schriftstück.
Ich öffnete das Fenster und ließ sie herein. Sie hüpfte über den Fensterrahmen und
landete schließlich auf der Lehne des Sessels. Brav streckte sie mir ihr Bein hin,
damit ich den Brief losbinden und lesen konnte.
Großer Abenteurer,
hiermit erhältst du deine Brieftaube. Erstatte Bericht, so wie es dir vorgegeben ist.
Der Rat
Ich war tatsächlich vorher schon darüber informiert worden, dass ich alle zwei
Monate Bericht erstatten soll. Das fand ich zugegeben ziemlich eigenartig, da mein
Erkundungsland laut Karte ziemlich klein und nicht besonders weit weg war. Aber
wieso nicht, Urlaub in einem anderen Land ist sicherlich ganz schön. Zumindest
habe ich das aus Erzählungen meiner Familie gehört. Als man noch reisen durfte.
Oder aus der Zeit, als meine Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren noch nicht hier lebten. Da gab
es viele spannende Geschichten drüber. Ich habe sogar mal von einem Tagebuch
gehört, was einer dieser Ur-Vorfahren geschrieben haben soll. Ob es das wirklich
gab, war fraglich, da früher so gut wie niemand schreiben konnte. Seit vielen Gene-
rationen wird es dennoch in unserer Familie gelehrt und ich werde eines Tages die
Pflicht haben, es meinen Kindern beizubringen.
Den Zettel faltete ich zusammen und steckte ihn zu meinen anderen Sachen in
den Packsack. Die Taube beobachtete mich dabei, immer den Kopf schräg gelegt,
als würde sie mich etwas fragen wollen. Was genau, verstand ich allerdings nicht.
„Hast du einen Namen?“, fragte ich deshalb.
Nichts. Sie starrte mich nur weiter an.
„Dann muss ich mir wohl einen ausdenken.“
Mein Blick glitt aus dem Fenster in den Himmel. Just in diesem Moment flog
eine Sternschnuppe durch mein Sichtfeld, und nachdem ich mir gewünscht hatte,
68
dass die Reise gut und weitestgehend gefahrlos verlief, hatte ich auch schon einen
Namen: „Cosmia. Ab heute hörst du auf den Namen Cosmia.“
Wieder keine Antwort. Vielleicht würde mir ein bisschen Schlaf dabei helfen,
nicht mehr zu erwarten, dass eine Taube mir antworten würde. Ich ließ sie einfach
auf dem Sessel sitzen und legte mich ins Bett. Meine Rüstung war poliert, meine
Lanze gespitzt und ich so aufgeregt, dass ich mich einige Male hin und her wälzen
musste, bevor der Schlaf endlich zu mir fand.
In aller Herrgottsfrühe war ich aufgestanden, nicht nur, um mich meiner Mutter
zu entziehen, sondern auch, weil ich es vor Spannung gar nicht mehr aushielt. Ich
machte mich direkt auf den Weg.
Ich hatte eine große Karte dabei, die allerdings bis auf eine kleine Ecke voll-
kommen leer war. Diese Ecke war der Teil von Volkesland, der die Grenze zu dem
mysteriösen, unergründeten Land bildete, welches in Kürze vor mir liegen würde.
Um mir die Zeit zu vertreiben, trällerte ich ein Lied vor mich hin, welches ein Barde
für die Ritterschaft gesungen hatte. Es handelte sich dabei um eine Art Motivations-
lied, und heute motivierte es mich noch mehr, als ich es eh schon war.
Endlich! Ich setzte meinen Fuß über die Grenze. Ein großes Stück Mauer, die
einst Volkesland von den Nachbarländern abgeschirmt hatte, war herausgerissen
worden. Dahinter drängte sich Baum an Baum, die Erde war verschlungen von zart-
grünem Gras. Auch mein zweiter Fuß berührte nun den ausländischen Boden. Um
mich herum herrschte Stille. Kein Wind war zu spüren, kein Lebewesen zu hören,
einfach Stille. Die Sonne küsste die Baumkronen und es wurde Zeit, mein Lager
aufzuschlagen, der Sicherheit halber erstmal in der Nähe der Grenze. Ich freute
mich darauf, nach diesem langen Weg endlich meine Füße ausruhen zu können.
Zufrieden legte ich mich unter mein Zelt, welches ich gerade aufgebaut hatte.
Das Wetter war gut, kein Regen zu erwarten. So wie ich es gesehen hatte, waren es
nur leichte Schleierwolken, die die Sonne verdeckten. Ich wollte so gerne schlafen,
aber wieder war es meine Neugierde, die das nicht zulassen wollte. Lieber gleich
alles erkunden, lieber gleich Berichte schreiben, lieber gleich…
Aber ich war so müde, dass ich mich auf die Seite drehte und einfach nicht wider-
stehen konnte. Die Reise hierher war müßig gewesen, hügelig. Und schon das
Laufen hatte ich des lästigen Schlafens wegen vernachlässigen müssen. Nun stelle
man sich vor, ich trug ja meine Rüstung! Auch jetzt. Das hatte ich bei meiner Aus-
bildung ganz schnell gelernt: Sei immer auf der Hut und schütze dich gut! Und so
tat ich es auch hier. Als ich am nächsten Morgen die Augen öffnete, fühlte ich mich orientierungslos.
Über mir war alles grün, es gab keine Umgebungsgeräusche, nicht mal Wind. Nur
die kleine Taube neben mir, die nur dasaß und mich beobachtete, gab mir einen
Hinweis auf meine Mission. Dieses Land wollte erkundet werden!
In den ersten Tagen verschaffte ich mir einen groben Überblick. An einen dicken,
sehr alten Baum war ein Schild genagelt, auf dem in verschnörkelter Schrift ‚Allab-
astye‘ stand. Ich vermutete das als Namen des Landes. Mein Lager hatte ich ganz
oben auf einem der zwei Berge aufgeschlagen. Nachdem ich von Tag zu Tag auf
immer höhere Bäume kletterte (ja, das ging erstaunlich gut mit der Rüstung), ver-
stand ich auch, wie das Land aufgebaut war. Durch die Größe schaffte ich es sogar,
zumindest vermutungsweise, das ganze Gebiet zu überblicken. Zwei hohe Berge
mit gebietsweisen, weißen Flecken. Die Berge waren beide im unteren Teil sehr
steil, wurden nach oben hin aber immer flacher. Ich hatte glücklicherweise einen
kleinen Schleichpfad gefunden, sehr gut versteckt hinter einem dichten Busch und
einer ausgelösten Ork-Falle ohne Ork. Dieser Pfad wurde schnell zu einer Treppe
mit hohen Stufen, die aussah, als hätte sie jemand vor vielen Jahren selbst gebud-
delt und geformt. Merkwürdig. Bisher hatte ich noch keine Lebewesen entdeckt.
Gehört hatte ich sie mittlerweile, in der Nacht hatte irgendwas geheult, vielleicht
ein Werwolf ?
Zwischen den Bergen gab es keine Verbindung und ich konnte mir noch nicht
vorstellen, wie ich da rüberkommen sollte. Vermutlich klettern und hangeln, entlang
an den ausladenden Wurzeln der dort wachsenden Bäume. Im Tal lag ein Fluss, viel-
leicht vielmehr ein Bach, vielleicht zwei Meter breit. Den Ursprung oder das Ende
dessen war nicht erkennbar, aber bestimmt floss er über die Ländergrenze hinaus.
Was die anderen Reisenden wohl so gerade trieben oder erlebten? Von Zeit zu Zeit
wünschte ich mir, ich hätte eine Begleitung mitgenommen. Eine sprechende, nicht
so wie Cosmia, die zu meiner wichtigsten Bezugstaube geworden war. Nur antwor-
tete sie eben nicht, was schade war. Wäre ich ein Magier oder auch nur irgendwie
magisch begabt, hätte ich sie bestimmt zum Sprechen gebracht. Manchmal legte sie
ihren Kopf schief oder hatte einen ganz starken Ausdruck in den Augen, als würde
sie gerne etwas sagen wollen. Dann käme bestimmt sowas raus wie „Sei kein Idiot,
dieser Baum ist eine Nummer zu hoch für dich“ oder „Für diesen Job werde ich zu
wenig bezahlt“, so wie man sich das eben vorstellt, könnte das Haustier auf einmal
sprechen.
Heute wollte ich das erste Mal so richtig etwas erkunden und herausfinden, was
diese weißen Flecken waren. Dazu ging ich einfach stur nach Westen.
70
Nach ungefähr einer halben Meile sah ich im Dickicht etwas schimmern und ging
näher ran. Vor mir stand eine Blume, einen Meter groß, mit einem fleischigen Stiel.
Sie duftete wie der schönste Duft, den ich bis dahin hatte riechen dürfen, sie zog
mich förmlich an. Ihre Blätter waren dunkelviolett und weit geöffnet, wie ein Maul,
das seine Beute bald fangen und verspeisen würde. Darin lag etwas, das wie eine
Kugel aussah, gefüllt mit einer gold-fluoreszierenden Flüssigkeit. Neugierig streckte
ich meinen Finger danach aus. Als ich sie berührte, schnappte nicht etwa das Maul
zu, nein, die Kugel platzte und verteilte ihren Inhalt über meinen Helm, der glückli-
cherweise mein Gesicht bedeckte und meinen Brustpanzer. Jetzt roch es nicht mehr
so gut, ziemlich eklig sogar und ich nahm wieder einige Schritte Abstand. Es klirrte
leise und ich geriet ins Wanken, konnte mich aber auf den Beinen halten. Erschro-
cken drehte ich mich um, nur um eine zweite dieser Pflanze zu entdecken, die sich
in meinem Rückenpanzer verbissen hatte. So fingen diese Blumen also ihre Beute.
Ich zerrte an dem Stiel und riss die Blume ab, die sich an meiner Rüstung sicher
die Zähne ausgebissen hatte. Zurück blieben seichte Furchen in meiner Rüstung.
Als ich meinen Weg fortsetzte, sah ich immer mehr dieser Blumen, doch hielt
mich weit fern von ihnen. Irgendwann säumten sie den Wegesrand, als würden sie
mir den Weg weisen wollen. Aber wohin nur? Zu den weißen Flecken? Oder zu
gefährlicheren Blumen? Papperlapapp, ich war doch ein Ritter! Und Ritter hatten
vor nichts Angst, so wie auch ich vor nichts Angst hatte und mich freiwillig hierfür
gemeldet hatte. Wieder schweiften meine Gedanken zu den anderen Reisenden
und welcher Gefahr sich diese wohl aussetzen müssten. So ganz ohne Rüstung und
ohne Ausbildung.
Gedankenverloren stieß ich mir den Fuß an einem herumliegenden Stein. Es
schepperte leise, aber mein Fuß blieb natürlich heil. Ich sah mir den Stein näher
an, er leuchtete weiß. Dann sah ich auf und traute meinen Augen kaum: Vor mir
türmten sich Gebäude aus eben diesem weißen Stein auf. Manche waren klein, ein-
stöckig, aber manche waren auch größer. Sie hatten allesamt zwar Fenster, aber keine
Scheiben und keine Türen, nur Öffnungen im Stein. Ich betrat das nahestehende
Gebäude. Es gab keinen Fußboden, nur Gras und noch mehr bunte, große Blumen.
Mitten im Raum stand eine Marmortreppe, die nach oben führte. Langsam betrat
ich sie und der Stein war wie zu erwarten stark genug, um mich zu halten. Es gab
kein Geländer und so tastete ich mich langsam voran. Irgendwo knisterte es, viel-
leicht war da oben jemand. Und ich Idiot hatte gar keine Waffe dabei! Jetzt hieß es
Augen zu und durch und als ich oben ankam, war da niemand, alles leer. Ein großer
Raum, so wie unten, nur dieses Mal mit einem Boden, aber ohne Dach.
71
Später als ich durch das kleine Dörfchen lief, konnte ich nicht einordnen, ob es ver-
lassen war, oder die Wesen, die hier gelebt hatten, einfach sehr minimalistisch gelebt
hatten. Denn eines war klar: Hier war niemand mehr, zumindest lebte hier niemand.
Die Gebäude sahen von innen größtenteils gleich aus, manche hatten mehr Wände
als andere. In einem Haus hatte ich einen überraschenden Fund gemacht: Ein altes,
vergessenes, in Leder eingebundenes Buch. Ich nahm es erstmal an mich. Am Ende
des Weges thronte ein Turm, der alle Häuser überragte, dennoch nicht riesig war.
In seinem Inneren befand sich eine Wendeltreppe und mir war klar, dass dies hier
ein Ausguck gewesen sein muss, vielleicht auch ein Stützpunkt für Bogenschützen.
Tatsächlich fand ich oben einen alten Bogen und eine weitreichende Aussicht, dem
Fluss entgegen. Hinter mir wuchs ein Baum den Turm hoch und nahm einiges an
Platz ein, woraus ich schlussfolgerte, dass hier lange keiner mehr die Äste gestutzt
hatte. Cosmia ließ sich gleich auf einem der Äste nieder. Auch ich suchte mir einen
kleinen Vorsprung, auf dem ich sitzen konnte und begann, meinen ersten Bericht
zu schreiben.
„Okay Cosmia, du musst mir jetzt ganz genau zuhören.“ Ich blickte die leicht
ergraute Taube, die vor mir auf einem Ast hockte, gebannt an. „Du hast zwar
federnah miterlebt, was wir die letzten Tage erforscht haben, aber ich weiß, du bist
manchmal etwas theatralisch. Deswegen teile dem Rat bitte folgendes mit.“
Cosima drehte ihren Kopf, als ich knisternd meine Pergamentrolle ausrollte.
„Ruinen aus weißem Marmor, stechende Düfte von irren aussehenden Pflanzen,
hohe Bäume, bisher keinerlei Kreaturen gesichtet. Raschelnde Blätter bei Wind-
stille, leises Heulen in der Nacht. Meine Rüstung quietscht, ich bräuchte langsam
eine neue. Ein Pferd wäre auch nicht schlecht.“
Tief einatmend ließ ich das Pergament durch meine Finger gleiten. „Das Land ist
klein und besteht aus zwei Bergen, die durch ein Tal getrennt sind. Durch das Tal
fließt ein Fluss. Ich weiß nicht, wo er endet. Der Übergang zum anderen Teil des
Landes scheint unmöglich, zu steil. Wir müssen noch einen Weg finden, da rüber-
zukommen. Melde mich zum nächsten Termin mit neuen Infos.“
Schweren Herzens band ich ihr die Rolle ans Bein und befahl ihr, diese zum Rat
zu bringen. Sie warf mir noch einen Blick zu und erhob sich dann in die Lüfte. Ich
winkte ihr kurz nach und war dann ganz allein. Mein Blick entschied sich dazu, über
das Tal zu schweifen und mich somit etwas abzulenken. Der Fluss. ich musste als
nächstes zum Fluss! Und danach musste ich es irgendwie hinüber zu dem anderen
Berg schaffen, denn auch dort zeigten sich die weißen Flecken, die, wie ich jetzt
vermuten konnte, auch ein Dorf sein mussten. Vielleicht ja sogar mit Bewohnern.
72
In der Ferne hörte ich ein leises Wimmern, dann ein Platschen. Es wurde langsam
dunkel.
Die nächsten Wochen wurde dadurch verschlungen, dass ich den gesamten Berg
von oben nach unten durchkämmte, doch bis auf das kleine Dorf hatte es bisher nur
Wald gegeben. Vielleicht lag das an der Nähe zu Volkesland und dass die Bewohner,
wenn es denn noch irgendwo welche gab, sich davon fernhalten wollten. Nun, eine
hilfreiche Sache hatte ich doch gefunden und ich stand genau vor ihr: Eine Hänge-
brücke. Schmal und fragil sah sie aus, aber benutzbar. Cosmia sah mich wieder mit
diesem Blick an, der so etwas bedeutete wie: „Willst du das wirklich wagen?“ Und
ja, das wollte ich, nein, musste ich sogar. Das war meine Pflicht als edler Ritter. Doch
die erste Planke zerbrach direkt und ich sprang wieder zurück auf das feste Land.
Vielleicht war die Brücke doch keine gute Idee.
Bisher hatte ich auf dieser Landesseite keinen Weg hinab zum Fluss gefunden
und ihn deshalb auf der anderen Seite vermutet. Jetzt saß ich auf einem Ast und ver-
suchte, mir noch einmal ein Bild von der Umgebung zu machen. Mittlerweile war
ich müde geworden vom andauernden Herumlaufen und Nichts-Finden. Das Dorf
vor ein paar Wochen war das erste und letzte Erfolgserlebnis geblieben. Die Brücke
war unbrauchbar. Als ich zum gefühlt hundertsten Mal meine Zeltplane aufschlug,
fiel mir das Buch in die Hände. Bisher hatte ich es nicht aufgeschlagen, nein, sogar
in meinem Beutel vergessen. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich
wissen wollte, was da drinstand. Heute würde ich ohnehin keinen Schritt mehr
gehen.
„Forschungstagebuch Dr. Gesine Schnabel – Tag 108 (30.08.2023): Nach jetzigem
Standpunkt muss Zeitreise möglich sein. Wir haben noch keine Beweise und noch kein ein-
ziger Versuch hat geklappt, aber ich min mir ganz sicher. Die Moleküle im Körper haben
diese (meiner Meinung nach) vielversprechende Struktur. Wenn Prof. Dr. Bob Madley
und ich nicht bald etwas vorlegen, wird unser Projekt eingestampft. Gezeichnet: Dr. Gesine
Schnabel, Stempel der Humboldt-Universität zu Berlin.“
Ich gähnte. Zeitreise, was für ein Märchen! Die Seiten vor der 108 waren heraus-
gerissen worden, ebenso viele Seiten in der Mitte und am Ende. Vielleicht standen
dort Dinge drauf, die würdig gewesen waren, sie mitzunehmen und nicht wie den
Rest des Buches zurückzulassen. Berlin – ob das eine Person war? Vielleicht eine
ranghohe, eine Königin oder ein König. Oder der Name einer Institution oder
einer Stadt? Erst dann fiel mir auf, wie merkwürdig es war, dass es in einer Sprache
geschrieben war, die ich einwandfrei verstand! Und dass Frau Doktor den gleichen
73
Vornamen wie meine Mutter trug. Seltsame Zufälle. Ich schloss daraus, dass die
Landessprache wohl auch dieselbe sein musste, wie die, die wir zuhause in Volkes-
land sprachen. Ich hoffte darauf, irgendwann mal jemanden zu treffen und diese
Sprache nicht schon verlernt zu haben. Aber wie würden die Einheimischen auf
mich reagieren? Wussten sie, dass Volkesland ihnen nicht länger feindlich gesinnt
war? Und was für Wesen lebten hier wohl? Auch bunt gemischt, so wie zuhause?
Ich suchte lange nach einer Lösung, wie ich es anstellen sollte, nun endlich
zum Fluss zu kommen und kam nicht drauf. Es blieb keine andere Lösung als die
Brücke. Ich informierte Cosmia darüber, die natürlich nicht begeistert war. Ich
musste sie ignorieren und am nächsten Morgen stand ich wieder an der Brücke, wo
nun die erste Planke fehlte, vielleicht war ja nur diese morsch gewesen? Ich stellte
mich also auf die zweite, die tatsächlich hielt! Langsam ging ich voran und testete
erstmal jede Planke. Einige musste ich überspringen, aber am Ende schaffte ich es
bis nach drüben. Nur noch die letzte Planke… knacks, sie zerbrach unter meinen
Füßen und ich konnte das Geländer nicht mehr rechtzeitig greifen. Der Boden
kam schnell, dafür rollte ich in einem Wahnsinnstempo den Abhang hinab. Dank
meiner Rüstung zog ich mir dabei nur ein paar Beulen zu. Anschließend landete
ich im Fluss.
Es hätten Sekunden, Stunden oder Tage sein können, die ich im Wasser verbracht
hatte. Die Rüstung war so schwer und ich glaube, immer weiter abzusinken. Wasser
lief in meine Nase, in meine Ohren und meinen Mund, Jetzt war´s vorbei mit mir.
Da begann jemand an mir zu ziehen und das Licht kam näher, Oma, wir werden uns
wiedersehen! Ich musste husten. Dann gingen meine Augen wieder auf, trotzdem
blieb alles schwarz.
„Ein Mensch!“ fiepte eine hohe Stimme knapp neben meinem Ohr, als mir der
Helm abgenommen wurde. Tageslicht berührte meine Netzhaut und ich blickte in
den Himmel, gesäumt von hohen Bäumen. Mein Körper war nicht nur kalt, son-
dern auch klitschnass.
„Das erklärt einiges“, grummelte jemand anderes.
„Sei doch nicht so Vater, der Mensch braucht Hilfe!“
Links von mir war der Fluss, aus dessen Oberfläche ein Oberkörper hervorbrach.
Und ein Kopf mit einem netten Gesicht und großen Augen. Ein Meermädchen.
Sonst sah ich keinen. „Wo bin ich?“, fragte ich noch etwas benebelt.
„Am Flussbett. Du bist auf einmal einfach ins Wasser gefallen. Wusch, einfach
so!“
„Und wer bist du?“
Ich fühlte mich wieder klarer im Kopf und wollte diese Gelegenheit nutzen, um
etwas über dieses Land herauszufinden. „Und lebt hier sonst noch wer?“
„Ja, also …“, begann sie, wurde jedoch von der anderen Stimme unterbrochen:
„Lydia, hör auf, dem Menschen Schwachsinn zu erzählen und hilf mir lieber bei
den Vorbereitungen für das Fest morgen.“ Lydia nickte mir entschuldigend zu und
tauchte dann ab.
Ich versuchte mich am Aufstehen, um mich ein paar Meter weiter in die Böschung
zurückzuziehen. Dort fand ich auch meinen Beutel wieder, der glücklicherweise
nicht ins Wasser gefallen war. Und Cosmia, deren Blick ich bewusst mied. „Habe
ich es dir doch gesagt!“, wollte sie mir sicher sagen.
Ich pellte mir nach und nach die Rüstung vom Leib. Sie und ich mussten unbe-
dingt schnell trocknen, damit ich mit meiner Mission fortfahren konnte. Im Hinter-
grund erklang ein Kichern und Zischen, und ich konnte viele Meermenschen im
Fluss an mir vorbeiziehen sehen. Hier in meinem kleinen Versteck. Die Rüstung
musste so schnell wie möglich wieder an, wenn ich schon keine Waffe hatte, um
mich zu verteidigen. Da fiel mir die Pergamentrolle ins Auge.
„Nun ist es schon wieder soweit, der zweite Bericht muss von dir geliefert werden,
Cosmia.“ Ich nickte meiner Taube zu. „Fassen wir nochmal zusammen, was in der
letzten Zeit geschehen ist.“ Ich rollte, um noch einmal alles auf seine Korrektheit zu
überprüfen, die Pergamentrolle aus.
„Bin den Abhang runtergestürzt, aber alles okay, lebe noch. Bin quasi runtergerollt.
Anschließend in den Fluss gefallen. Ein Meermensch beschwert sich, dass ich ihn
angerempelt hätte und will mir folglich keine Informationen über das Land geben.
Er war nicht der einzige Meermensch, den ich gesehen habe. Hier im Fluss sind
viele in einem unsagbaren Tempo an mir vorbeigerauscht. Meeresmensch-typi-
sches Kichern. Ich habe gehört, dass sie sich auf ein Frühlingsfest vorbereiten, und
nehme mir vor, das zu beobachten. Aber mit einer Rüstung kann man sich schwer
leise und unauffällig verstecken. Im nächsten Bericht mehr dazu. Am Horizont
thront eine schmale Hängebrücke. Sie führt auf die andere Seite des Landes. Muss
mir überlegen, wie ich diesen Abhang wieder hochkomme, um auch den letzten
Winkel dieses überschaubaren Landes zu erkunden.“
Vielleicht musste meine Rüstung noch so lange ausbleiben, bis das Fest vorbei
war, damit ich sie ungestört beobachten konnte. Bis morgen. Wie spät es wohl war?
Von hier aus konnte ich die Sonne nicht sehen. Cosmia war nun auch wieder fort
und ich lehnte mich an eine herausragende Wurzel. Die Hälfte des Landes hatte ich
nun schon erkundet, blieb nur noch der zweite Berg, wovon ich noch nicht wusste,
75
wie ich hochkommen sollte. Mein Kopf puckerte leicht und ich schloss meine
Augen. Nur noch fünf Minuten…
Geweckt wurde ich von einer Trompete, eine Fanfare eher. Ich schreckte hoch
und bemerkte, dass ich nicht nur geschlafen hatte, sondern das auch noch ohne jeg-
lichen Schutz! Aber ich lebte noch, mir ging es verhältnismäßig gut. Die Gestalten
hier schienen nicht feindselig zu sein. Angelockt von der nun spielenden Musik,
steckte ich mein Gesicht durch die Zweige. Musik spielen sah ich keinen, dafür aber
eine Menge junger Leute in weißen Gewändern, in der Hand Kränze aus Zweigen.
Diese legten sie nach und nach in den Fluss und sahen ihnen nach, bis sie, platsch,
verschwanden. Dann jubelte einer der Jünglinge auf. Die Bedeutung davon hätte
ich nur zu gerne verstanden, aber vielleicht… Ich riss wenige, dünne Zweige des
Strauches vor mir ab und begann, sie ineinander zu flechten, bis daraus ein Kranz
entstand. Als es Abend wurde und keine Seele mehr anwesend war, schlich ich
hinaus. Ohne Rüstung. Und ich legte meinen Kranz auf das Wasser und sah ihm
nach, wie er flussabwärts trieb. Er trieb langsam vor sich hin und schaukelte leicht.
Ich setzte mich ans Ufer und seufzte. Die Haare fielen mir ins Gesicht. Als ich sie
weggestrichen hatte, war der Kranz aus meinem Sichtfeld verschwunden. Das
Geheimnis dessen würde mir wohl verwehrt bleiben, würde ich keinen finden, der
es mir erklären könnte.
Platsch! Vor mir tauchte wieder dieses Gesicht auf, die großen Augen. „Lydia?“
„Ich dachte schon, du legst mir nie einen Kranz ins Wasser.“ Sie lächelte mich ver-
spielt an, faltete ihre Ellenbogen auf dem Ufer und legte ihren Kopf darauf.
„Du hast also meinen Kranz?“, fragte ich nach.
Sie nickte langsam und dann fiel er mir in ihrer wirren Haarpracht auf.
„Und was bedeutet das jetzt? Ich habe all diese jungen Wesen beobachtet, wie sie
jubelten. Gibt es für mich auch einen Grund zum Jubeln?“
„Nun ja…“ Sie kratzte ich verlegen am Ellenbogen. „Das bedeutet, dass du mein
Angetrauter wirst und mich mit an Land nimmst.“ Sie ließ ihren prächtigen Fisch-
schwanz an die Oberfläche gleiten. „Und ich weiß nicht einmal, wie du überhaupt
heißt.“
„Vanda!“, antwortete ich schnell. „Vanda heiße ich! Aber ich kann dich nicht
heiraten.“
„Du musst. Das sind die Bedingungen, wenn man am Frühlingsfest teilnimmt.
Sobald du einen Kranz aufs Wasser legst, stimmst du automatisch zu.“
Sie wirkte etwas beleidigt.
„Lydia, ich kann dich jetzt nicht heiraten. Ich bin auf einer wichtigen Mission.“
76
„Was denn für eine?“
„Ich bin hier aus Volkesland und-“
„Woher?“
„Volkesland, nebenan, wir haben uns umbenannt, nachdem die Königsfamilie
geputscht wurde.“
„Wie bitte?“ Ihre Augen weiteten sich.
„Ich bin einer von vielen Überbringern dieser frohen Kunde! Und ich möchte
auch noch den Rest des Landes kennenlernen und es überall erzählen.“
„Das solltest du besser tun. In Mamoria wird dich einiges erwarten.“ Sie deutete
den zweiten Berg hoch, auf die weißen Flecken.
„Du wartest hier auf mich?“
Sie nickte lächelnd und tauchte dann wieder ab, meinen Kranz auf dem Kopf
ruhend.
Ich hatte die Rüstung wieder angelegt und Cosmia war zurückgekommen. Sie
freute sich für Lydia und mich. Da ich jetzt die Gewissheit hatte, dass auf dem
zweiten Berg jemand leben musste, fühlte ich mich in meiner Schutzuniform deut-
lich wohler. Ich stand jetzt am Abhang und betrachtete die Bäume, Sträucher und
vor allem die Wurzeln, an denen ich mich hochziehen könnte. Und dann kletterte
ich einfach drauflos. Ich fand immer wieder Gehölz in Greifreichweite, an dem ich
mich hochziehen konnte und sah besser nicht nach unten in die Tiefe. Cosmia,
dachte ich, wenn ich nur so fliegen könnte wie du!
Am Abend lag ich bäuchlings unter meinem Zelt und blätterte wieder in dem
Tagebuch.
„Forschungstagebuch Dr. Gesine Schnabel – Tag 177: Nun sind wir schon seit zwei
Wochen hier in Allabastye und finden keinen Weg zurück nach Berlin. Wie auch? Wir sind
in einer Zeit gelandet, wo es noch nicht einmal Elektrizität gibt! Bob verliert seinen Verstand
und schlägt vor, dass wir uns hier ein neues Leben aufbauen. Aber wie soll das gehen?! Als
Menschen zwischen Elfen, Orks, Zentauren, Magiern und Meermenschen? Wir würden nie-
mals akzeptiert werden. Er wird schon sehen. Ich jedenfalls werde weiter versuchen, wieder
nach Hause zu kommen. Gezeichnet Dr. Gesine Schnabel.“
Ich konnte bezeugen, dass es als Mensch hier schwer war. Seit jeher hatte meine
Familie Diskriminierung erleben müssen. Auch das versteckte die Ritterrüstung,
dass ich nicht zaubern konnte, keine Flügel hatte und keinen Fischschwanz. Ich war
ein Mensch und meine Familie war die einzige menschliche in ganz Volkesland.
Wir waren weitestgehend unter uns geblieben, Selbstversorger gewesen.
77
Als es früher noch Menschen gab, wollten sie die Wesen ausrotten und die Welt
für sich haben. Als ich zum Ritter wurde, wollte ich mich genau da gegen stellen. Die
Menschen mögen grausam gewesen sein, ich war es nicht.
Nachdem ich mir wie immer einen Überblick über meine Umgebung verschafft
hatte, wollte ich nach Mamoria ziehen. Ob Lydia mich begleitete hätte, hätte sie
Beine? Sie hätte auch bestimmt einen leichtern Weg nach hier oben gekannt. Jeden-
falls schien die Umgebung hier der auf der anderen Seite des Landes zu gleichen.
Nur gab es hier mehr von den Bäumen mit den essbaren Früchten dran. Und auch
die Wurzeln hier waren genießbarer. Es roch förmlich nach Leben, aber noch war
ich keinem begegnet. Die Blumen hier waren hübsch und gar nicht so bedrohlich,
auch wenn hier und da mal eines dieser violetten Biester wuchs.
Irgendwann sprang mir ein Schild ins Auge: Mamoria und ein Pfeil nach rechts.
Ich bog also ab und stand wenig später in einer genauso verlassenen Stadt wie
drüben. Nur waren die Häuser nicht ganz so heruntergekommen und hatten sogar
Türen. Nach einer Weile konnte ich Stimmen wahrnehmen, die in naher Ferne
sein mussten. Langsam und leise ging ich den Hauptpfad entlang, auch hier war an
dessen Ende ein Turm. Der Turm schien einen großen Vorhof zu haben, der durch
die strahlend weißen Wände abgegrenzt war. Nach einer Weile war ich mir sicher,
dass die Stimmen von dort kamen.
„Die Verliebten schauen sich an, aber gehen in getrennten Betten wieder schlafen.
Die Werwölfe erwachen!“
Verliebten? Schlafen? Werwölfe? Es war weder dunkel noch Vollmond, also
wovon redeten diese Wesen?
„Der Tag beginnt und Paulus ist tot! Klagt euch an.“
„Man, wieso muss ich immer als erstes sterben?“
Ein junger Zentaur kam auf das eiserne Tor zu, das den Hof vom Hauptweg
trennte. Gleich würde er mich erblicken und –
„EINDRINGLING!“ Wenige Sekunden später waren dutzende Lanzen und
Pfeile gegen mich gerichtet.
„Wer bist du und was willst du hier?“, fragte mich die hochgewachsene Frau mit
den wilden, dunklen Locken und den Wolfsohren. Sie schien die Anführerin der
Bande zu sein. Die war es auch, die mich niedergeworfen und samt Rüstung an
einen Pfahl gefesselt hatte.
„Iff bin Fanda und iff komme in Fieden!“, nuschelte ich durch den Knebel hin-
durch. „Man, könnt ihr daf Ding nift abnehmen?“
Woraufhin sie den Knebel losband.
„Also nochmal!“
„Ich bin Vanda und ich komme in Frieden“, wiederholte ich mich.
„Ach ja, Vanda?“ Zu meinem Namen machte sie eine Gänsefüßchenbewegung
mit den Fingern. „Und woher kommst du?“
„Aus Volkesland. Von nebenan. Ihr wisst schon, da wo jahrelang große Mauern
drum waren. Die Regierung wurde geputscht und wir haben Volkesland gegründet.
Ich bin geschichtlich nicht gut, der Rat kann das sicher besser erklären.“
„Ihr habt WAS?“, kam es nun etwas verzweifelt aus den hinteren Reihen. „Heißt
das, wir haben das all die Zeit hier umsonst gemacht?!“ Jetzt brach Getuschel aus
und die Anführerin funkelte mich böse an. „Du lügst! Woher bist du wirklich? Und
was bist du?“
„Ich sage die Wahrheit, seht es euch doch selbst an! Wir wollen Freundschaft zu
den anderen Ländern aufbauen. Und ich – ich bin ein Mensch.“
Ein Raunen ging durch die Menge, sie hatten mit dem Tuscheln aufgehört.
„LÜGNER! Menschen gibt es doch nur in –“
„Ja“, unterbrach ich sie, „Menschen gibt es nur in den Mauern, eingesperrt, aber
die Mauern existieren nicht mehr. Wir sind jetzt frei, Volkesland ist endlich frei!“
„Und einen Pusch, sagst du, gab es? Wieso hörten wir nichts davon?“
„Nun, ihr lebt recht abgeschieden. Ich habe mehrere Wochen gebraucht, um
überhaupt hierher zu kommen.“ Sie wandte sich nun um und sprach zu der Menge:
„Es tut mir leid, Krieger, die Mission ist abgeblasen.“
Hier und da hörte ich ein „Och manno!“, und die Menge zerstreute sich. Die
Anführerin begann, mich loszubinden und ich nahm anschließend meinen Helm
- Dann gab ich ihr meine Hand. „Vanda.“
„Brie“, antwortete sie und nahm meine Hand. „Folge mir.“
Ich lief neben ihr den Hauptweg entlang. Brie hatte die Hände hinter ihrem
Rücken verschränkt, knapp über der Stelle, wo ihr ein Wolfsschwanz aus dem
Körper wuchs. Sie räusperte sich nach einer kurzen Stille.
„Wir haben uns nach Mamoria zurückgezogen, als die Lage in deinem Land
kritisch wurde. Seit jeher haben wir an unserem Plan gefeilt, um unsere verlorenen
Brüder und Schwestern zu rächen: Wir stürzen die Regierung! Nun kamt ihr uns
zuvor.“
Sie seufzte. „Nun sind wir quasi arbeitslos. Hier in Allabastye gibt es sonst nichts.
Keine Landwirtschaft, keine Märkte, keine Schulen. Wir hatten nur unsere Mission
vor Augen. Das Land ist verwildert, nur die Meermenschen im Fluss gibt es noch.“
79
„Ach ja, Cosmia, gut, dass du mich erinnerst.“ Erschöpft ließ ich mich auf einem
Stein nieder und kramte nach meinem letzten Stück Pergament. Dann begann
ich nachzudenken. Ich hatte an dem Frühlingsbrauch der Meermenschen teilge-
nommen, einen Kranz aus Zweigen geflochten und ihn ins Wasser gelegt. Zu meiner
Überraschung war er nach ein paar Minuten verschwunden. Dann machte ich mich
auf den Weg, ich hangelte mich den Abhang hoch, von Baum zu Baum. Ich setzte
die Feder an, denn eine spannende Sache war ja doch passiert: „Komme auf der
anderen Seite der Schlucht an, werde sofort angegriffen! Mit Lanzen und Pfeilen,
alle auf mich los. Bestimmt 30 Leute. Verschiedenste Kreaturen. Meine Rüstung hat
einige Beulen abbekommen! Nach der Verständigung erzählten sie mir, sie würden
einen Putsch gegen die Regierung in Volkesland planen. Ich klärte sie darüber auf,
dass dies bereits geschehen ist, scheinbar hatten sie es nicht mitbekommen. Werde
sie wohl mit zurücknehmen, der Weg ist ja nicht weit.“
Ich wendete mich wieder Cosmia zu: „Mal sehen, was der Rat dazu zu sagen
hat.“
Brie hatte mir ein Bett in ihrem Haus angeboten, was ich gerne angenommen
hatte nach den ganzen Nächten auf dem harten Boden. Die Lage der Allabastyaner
war eindeutig: Hier konnten sie nicht bleiben. Zumindest nicht unter diesen
Umständen. Brie hatte mir erzählt, dass ihre Vorräte an Essen gerade einmal so
reichten und ihre Kämpfer viel zu dünn waren und über Hunger klagten. Dieses
Land war so lange sich selbst überlassen gewesen und die Natur holte sich zurück,
was einst ihr gehörte. Das Land war kaum größer als eine Hauptstadt und hatte
kaum Einwohner. Was war hier nur passiert?
Ich griff nach dem Tagebuch, in dem die zwei Forscher einer ähnlichen Lage vor-
gefunden haben mussten. Vielleicht fand ich darin Antworten.
„Forschungstagebuch Dr. Gesine Schnabel – Tag 245: Die Bewohner von Mahagonia
sind sehr nett und versorgten uns mit Nahrung. Bob arbeitet Tag und Nacht an unserem
neuen Haus. Was soll ich sagen – er hatte recht. Hier kommen wir nicht mehr weg. Glück-
licherweise gibt es in unserer Zeit nicht viele, die uns vermissen und somit möchte ich nach
vorne sehen und hier ein neues Leben beginnen. Gezeichnet: Gesine.“
Ich blätterte zum Ende. Was für eine merkwürdige Geschichte war das denn?
Menschen sollten hier per Zeitreise aufgetaucht sein? Lebten nicht schon immer
Menschen hier? Ich dachte, sie wären nur ausgerottet worden. Ein Blatt fiel leise zu
Boden und ich hob es auf.
„Forschungstagebuch Dr. Gesine Schnabel – Tag 160: Die Bewohner (Elfen, Magier,
Zentauren etc., ja, wie aus einem Märchenbuch) scheinen mehr Angst vor uns zu haben als
wir vor ihnen. Einer fragte danach, was für Wesen wir seien. „Menschen“ war für ihn kein
80
Begriff. Sind wir etwa die einzigen Menschen hier? Ich plane nicht, dass herauszufinden, nur
wieder nach Hause zu kommen. Gezeichnet Dr. Gesine Schnabel.“
Und das war´s. Die Geschichte von zwei Forschern, die hier gestrandet waren,
so wie es mir meine Mutter immer zum Einschlafen erzählt hatte. Auch ich war
nun schläfrig, legte das Buch weg, löschte das Licht und drehte mich zur Wand.
Zeitreisen…
„Brie! Brie!“ Mit der Antwort des Rates in der Wand, stürmte ich auf den großen
Platz. Ich hatte nun ein paar Wochen hier verbracht und die Bewohner und ihre
Bräuche kennengelernt. Es gab keine Kirche, sie glaubten an keinen Gott, und wenn
man mal jemanden beten sah, tat er das zu sich selbst. Essen konnte man hier fast
alles roh, Wurzeln, Blätter, Früchte. Sogar die Pflanzenbiester waren genießbar und
sogar eine Spezialität hierzulande. Brie hatte mir versprochen, mir eines Tages zu
zeigen, wie man die Blütenblätter entete. Zum Kochen blieb im normalen Alltag
keine Zeit. Der bestand aus Training am Vormittag und Freizeit am Nachmittag,
wobei die Gruppe meistens zusammensaß und Spiele spielte. Bries Lieblings-
spiel war Werwolf, was sie sich selbst ausgedacht hatte, da sie selbst von einem
abstammte.
Hier lebten überwiegend die jungen Leute, die nach der Dürre vor fünf Jahren
nicht verhungert waren. Brie war mit 35 die älteste in der Runde und deshalb zur
Anführerin gewählt worden. Seit die Dürre vorüber war, wofür sie meine Heimat
verantwortlich machten, hatte sich diese Kämpfergruppe gegründet, die seitdem
auf Rache aus war. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Ich fand Brie, lässig gegen
einen Baum gelehnt. „Ja?“
„Ich habe die Antwort. Der Rat. Er hat zugestimmt, ihr könnt mit nach
Volkesland!“
In den letzten Tagen hatten wir gelegentlich in der großen Gruppe zusammen-
gesessen und uns beratschlagt, ob ein Leben in Volkesland für die Mamorianer
vorstellbar war. Natürlich gab es Gegenwind und beinahe niemand wollte mich
nach Hause begleiten, doch als Brie von den knappen Vorräten durch den viel zu
kalten Winter berichtete hatte, musste auch der letzte einsehen, dass es sich so nicht
leben ließ. Aber sie wollten ihr Dorf nicht einfach so aufgeben und planten deshalb,
zurückzukehren und eine neue Zivilisation aufzubauen. Mit der Hilfe des neuen
Verbündeten Volkesland.
Doch zuvor wollte ich mich an mein Versprechen halten und Lydia wieder-
81
sehen. Am nächsten Tag machte ich mich auf zum Fluss, Paulus hatte mir einen
Schleichweg gezeigt. Es dauerte einige Zeit, bis meine Verlobte auftauchte, den
Kranz immer noch in den Haaren.
„Du hast dir ganz schön Zeit gelassen!“
„Bitte verzeih mir, Lydia, es war notwendig.“
„Bist du gekommen, um mich zu ehelichen? Denn nur dann kann ich Beine
bekommen und dir in deine Heimat folgen.“
„Wirklich? Oh, ich hatte gehofft, das kann bis zuhause warten“, gab ich zu und
setzte mich wie gehabt zu ihr ans Ufer.
„Soll das heißen, du hast gar nichts vorbereitet?“
„Nein, tut mir leid.“
„Heute fand eine Massentrauung statt, wenn wir Glück haben, ist der Vermähler
noch da.“ Lydia tauchte ab und ich wartete einige Minuten. Es war schon verrückt,
einfach so ein fremdes Mädchen zu heiraten. Meine Mutter hatte sich jedoch immer
gewünscht, ich käme eines Tages mit meinem oder meiner Zukünftigen nach
Hause. Und diesen Wunsch würde ich ihr nun erfüllen. Denn tatsächlich brachte
Lydia einen alten, bärtigen Meermann mit, der uns an Ort und Stelle zu Getrauten
erklärte. Lydia schwang sich samt ihrem schweren Fischschwanz auf meinen Schoß
(die Rüstung hatte ich in Mamoria gelassen) und als wir uns küssten, verwandelte
sich der Schwanz in ein paar Beine. Sie schien überglücklich zu sein und auch ich
war es bei ihrem Anblick.
Hand in Hand stiegen wir den Berg hinauf und ich stellte sie dem Dorf vor. Nach
der Hochzeitsnacht wollten wir den Marsch nach Volkesland wagen. Es mussten
noch einige Vorkehrungen getroffen werden.
Nun standen wir vor meinem Albtraum, der maroden Hängebrücke.
„Ich setze keinen Fuß mehr auf diese Brücke!“, protestierte ich und Brie brach in
Lachen aus, nachdem ich ihr meine Geschichte erzählt hatte.
„Auch nicht so?“ Sie rief nach Magnus, der an die Schwelle der Brücke trat, sich
hinkniete und die Planken mit beiden Handflächen berührte. Es erschienen aus
dem Nichts Lianen, die sich stabil um das Gerüst der Brücke schlangen. Das war
also der Trick der Einheimischen! Die Brücke sollte gar nicht an sich stabil sein,
sondern für Angreifer als Falle dienen! Und ich war darauf reingefallen. Nun, ohne
meinen Sturz hätte ich Lydia nicht kennengelernt, an deren Hand ich mich gerade
klammerte, während ich einen Fuß vor den anderen setzte. Sie kicherte dabei. Sie
konnte merkwürdigerweise direkt laufen, ohne irgendwelche Hilfe. Obwohl sie ihr
Leben lang einen Fischschwanz gehabt hatte. Cosmia flatterte wegweisend an uns
vorbei.
Es dauerte vier ganze Tage, bis wir die Grenze erreichten. Wir hatten aber auch viele Pausen eingelegt und die Gruppe hatte Lydia und mir Werwolfspielen beige-
bracht. Doch nun setzte ich meinen Fuß als erster auf Volkeslandboden und atmete
die Luft der Freiheit ein. Die Reise war das Beste, was mir hätte passieren können.
Obwohl ich den ersten Teil allein verbracht hatte, hatte ich doch eine Menge
Freunde und meine Frau gefunden.
Wir hielten wenige Wochen später eine richtige Hochzeit ab, zu der alle unsere
Freunde und meine Familie eingeladen waren und schmiedeten Pläne für unser
Leben danach, als Lydia schwanger wurde. Für uns stand fest: Wir wollten Allab-
astye wiederaufbauen und eines Tages dort leben.
Das gefundene Tagebuch meiner Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter Gesine Schnabel
stellte ich ins Regal und blätterte dann und wann darin. Außerdem erzähle ich die
Geschichte am Lagerfeuer. Magnus, der, wie sich herausstellte, schon wesentlich
älter war als geschätzt, konnte sogar noch Geschichten von ihr und ihrem Mann
Bob erzählen. Denn er hatte damals In Mahagonia gelebt und die beiden persönlich
gekannt. Sie waren wohl sehr lieb, wenn auch etwas exzentrisch gewesen.
Als unser Sohn auf die Welt kam, legte ich meinen Ritterdienst nieder und lernte
das Bauernhandwerk, um mich schon einmal auf die zukünftige Landwirtschaft in
Mamoria einzustellen. Lydia verdingte sich als Dichterin und Sängerin und berei-
tete vielen Leuten durch ihre wundervolle Stimme eine gute Zeit.
Und damit fand unsere Geschichte ein gutes Ende.
VOLKESLAND
Aufbruch ins Unbekannte
Eine Gemeinschaftsproduktion von Markus Heitz und der Schreibwerkstatt der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ Berlin, Marzahn-Hellersdorf unter Leitung von Renate Zimmermann
Illustrationen: Isabell Geger, Antje Püpke, Annika Baartz, Vivienne Pabst, Tim Gärtner
Herausgeber: Förderverein Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf e.V. und Renate Zimmermann
www.marzahner-promenade.berlin jetzt auch auf Instagram


